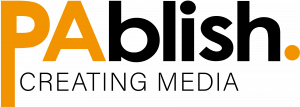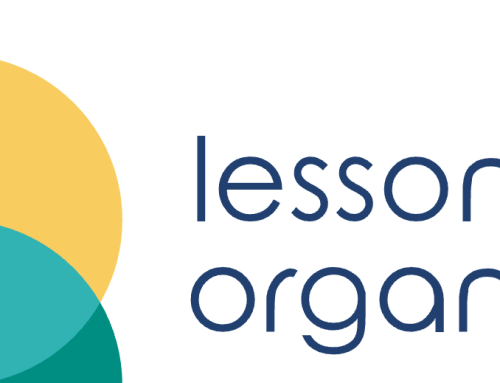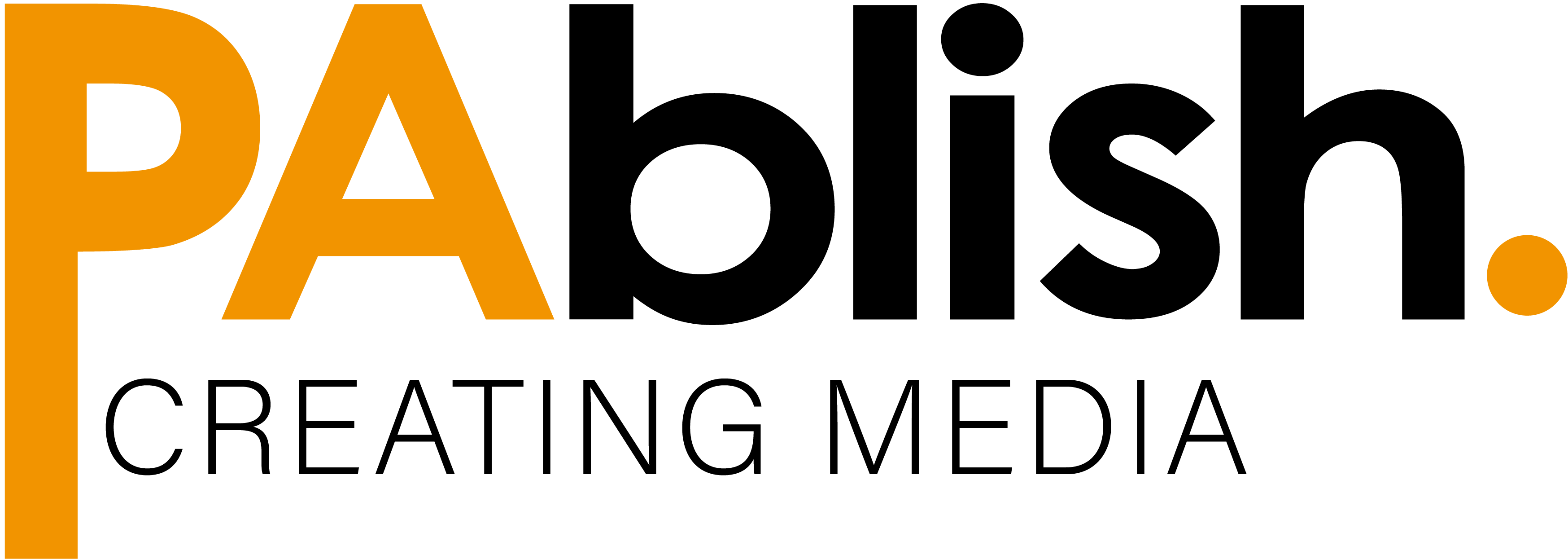Kleidung als Spiegel der Gesellschaft
Mode kann irritieren, provozieren oder einfach nur funktionieren, aber sie bleibt selten ohne Bedeutung. Kleidung erzählt von Zugehörigkeit, Abgrenzung, Erwartungen und Brüchen. Zwei junge Frauen, zwei unterschiedliche Stile, ein gemeinsames Thema: Wie wir uns kleiden, kann politisch sein, auch wenn es sich gar nicht so anfühlt. Zwischen Theorie, Alltag und Selbstbild entfalten sich Fragen, die unter der Oberfläche liegen.
von Lea Pfaffmann und Johanna Richardt

Quelle: Wade Austin Ellis
Es ist Freitagmittag in Passau, der Sommer hat gerade begonnen, die Fußgängerzone ist voller Menschen. Mittendrin liegt Almedinas Zuhause, im Herzen der Altstadt führt der Eingang durch ein altmodisches Metalltor, dahinter eine schmale Treppe. Im ersten Stock öffnet die Studentin die Tür zu ihrer Ein-Zimmer-Wohnung. „Sorry, es ist ganz schön heiß hier.“ Goldenes Lametta dient als Vorhang und trennt den kleinen Flur vom Rest des Zimmers, sie geht hindurch und breitet scherzhaft die Arme aus. „Klein aber fein.“ Jede Ecke in diesem Raum scheint eine Geschichte zu erzählen. Am Schrank hängen Fotos mit Freund:innen, daneben Luftballons von Spongebob und Patrick. Über dem Bett stehen Quietscheentchen, auf der Kommode eine Sammlung an bunten Lego-Sets. „Hier hab‘ ich sehr viel Herzblut reingesteckt.“ Almedina grinst und streicht sich durch die kurzen, lockigen Haare. Über ihrem weißen T-Shirt trägt die 25-Jährige eine schwarze Weste, die silbernen Ohrringe passen zu ihrem Septum-Piercing. Ihr Stil wirkt nicht geplant, aber auch nicht beliebig.

Almedina | Quelle: Lukas Rentz
Was sie anzieht, entscheidet sie spontan. Sie schaue morgens zuerst, wie es ihr geht, was ansteht, wie sich der Tag anfühlt. Mal ist es etwas Weites, Schützendes, an anderen Tagen darf es lauter sein, sichtbarer. „Ich fühle mich einfach wohl in Klamotten, die zeigen, wer ich bin und wer ich sein kann“, sagt sie. „Und das sind eben Klamotten, die vielleicht nicht so als typisch weiblich gelten am Ende des Tages.“ Früher sei sie eher eine „graue Maus“ gewesen. Bloß nicht auffallen, bloß nicht laut sein. Heute ist das anders. „Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich genau das repräsentieren will, jemand, der halt laut ist.“ Die Kleidung hilft ihr dabei, sich zu verorten, nicht innerhalb von Normen, sondern bewusst daneben. Fließend zwischen feminin und maskulin. „Wenn ich mich im Spiegel anschaue und die Klamotten trage, die mir gefallen und die mich widerspiegeln, dann bin ich schon sehr stolz darauf, wer ich eigentlich bin und was ich da aus mir gemacht habe.“ Für sie bedeutet ein Outfit nicht nur, gut auszusehen, sondern sich selbst zu zeigen. „Hauptsache, wir können uns in dem wohlfühlen, was wir tragen.“ Und vor allem: in dem, was wir sind.
Auch Valerie steht in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung, vom Balkon aus blickt man auf den Inn. Die 19-Jährige studiert Jura an der Universität Passau und wohnt abgelegen vom Trubel der Innenstadt. Drinnen ist es kühler, „zum Glück habe ich seit kurzem eine Klimaanlage.“ Man betritt die Wohnung direkt durch die Küche, auf der Arbeitsfläche steht ein Thermomix, sorgfältig ausgerichtet. „Der ist ganz wichtig.“ Der Raum wirkt aufgeräumt, fast makellos. Alles ist bewusst platziert. Die Einrichtung ist in Weiß gehalten: Schränke, Kommoden, Schreibtisch – klar strukturiert und minimalistisch. Kissen und Vorhänge sind hellgrau, vereinzelt findet sich Rosa als Akzent. Auf einem Tisch in der Ecke stehen frische Blumen, auf dem Schreibtisch ein kleines Holzkreuz mit der Aufschrift „Du bist mein Licht.“ Über dem Bett hängt ein Schwarz-Weiß-Foto, eine junge Frau in eleganter Kleidung vor einem Oldtimer. Valeries Großmutter, sie hat früher gemodelt.
„Ich achte total auf Details“, sagt Valerie. Nicht nur beim Einrichten, auch bei Kleidung. Gürtel, Schmuck, Farben, sie habe schon immer darauf geachtet, dass alles zusammenpasst. „Details machen ein Outfit oft erst richtig aus.“ Was sie trägt, entscheidet sie je nach Tagesplan, ob Uni, Arbeit oder Freizeit, alles hat seinen Rahmen. Meistens läuft sie schick rum, sagt sie, gerne mit Bluse oder auch mal einem Blazer. An anderen Tagen fühlt sie sich eher lässig, kombiniert dann Jeans und T-Shirt. „Es ist immer tagesformabhängig.“ Kleidung ist für sie ein Werkzeug. Eins, das zeigen soll, „welchen Teil von mir ich gerade betonen will“. Was sie anzieht, soll auch eine Wirkung haben. Man werde wahrgenommen, wie man sich kleidet. Gerade in einer Unistadt fällt auf, wer was studiert. „Selbst mein bester Freund sagt: Du läufst rum wie eine Jura-Studentin.“ Valerie glaubt, dass Kleidung ein bestimmtes Bild erzeugen kann. Seriosität, Ordnung, vielleicht auch ein gewisses Erwachsensein. „Viele Leute denken aber auch so verkopft, dass das genau so der Person entspricht.“

Valerie | Quelle: Lukas Rentz
Mehr als nur Stilfrage
Wie Menschen sich kleiden, sagt oft mehr aus, als es auf den ersten Blick scheint. Was als individueller Geschmack daherkommt, kann auch Ausdruck gesellschaftlicher Positionen sein, ob bewusst oder unbewusst. Kleidung ist nicht neutral. „Vor allem in der westlichen Kultur tendieren wir dazu, zu sagen, dass wir der Kleidung keine große Bedeutung beimessen und deswegen sagen wir: ‚Ich habe mich zufällig so angezogen.‘ Das ist natürlich nicht immer wahr“, so Antonella Giannone, Professorin für Modetheorie, -soziologie und Kostümgeschichte an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Oft entscheide man sich ganz klar für oder gegen bestimmte Dinge oder sei von äußeren Faktoren geprägt. Was kann ich mir leisten? Wieviel Zeit habe ich? Was hängt gerade griffbereit im Schrank? „Wenn man von Menschen wirklich erfahren möchte, ob sie der Kleidung keine große Rolle beimessen, muss man sie quasi zwingen, bestimmte Kleidungen anzuziehen. Bei Mainstream-Kleidung haben wir keine Probleme, aber wenn man uns sagt: Zieh mal dieses Kleidungsstück an, ein besonderes, und geh raus in die Gesellschaft!“ Gerade dann werde spürbar, wie eng Kleidung mit Identität und Bedeutung verknüpft ist. „Wir würden sehr ungerne Sachen anziehen, die uns nicht gefallen, die mit Bedeutungen verbunden sind, die wir überhaupt nicht teilen und so weiter.“
Die Verbindung zwischen Kleidung, Körper und gesellschaftlicher Rolle war immer vorhanden. Inzwischen wird sie auch öffentlich sichtbar und medial verwertbar. Giannone spricht von einer Zunahme politischer Aktionen, die durch Kleidung gemacht werden. Kleidung wird dabei nicht nur getragen, sondern gezielt eingesetzt, um zu protestieren, um sich zu solidarisieren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Beispielsweise bei Demonstrationen werde das deutlich, wenn sich Menschen auf einheitliche Farben einigen oder mit bestimmten Symbolen auftreten. „Ihr müsst euch vorstellen, was das für eine mediale Wirkung ist.“ Kleidung eignet sich für solche Situationen besonders gut, weil sie Bilder produziert, die sofort gelesen und weiterverbreitet werden können. „Und die sind sichtbar, die sind in der Lage, Aufmerksamkeit anzuziehen.“
Kleidung als Protest: Beispiele
Queen Elizabeth II. (2017): Bei der Parlamentseröffnung trug sie ein Outfit in Blau und Gold, viele sahen darin eine subtile Ansage gegen den Brexit.
Prabal Gurung (2017): In seiner Show auf der New York Fashion Week trugen Models T-Shirts mit Botschaften wie: „The future is female“ und: „Yes, we should all be feminists“.
Hazel Brugger & Thomas Spitzer (2021): Beim Deutschen Comedypreis trugen sie T-Shirts, auf denen „Konsequenzen für Comedian XY“ und „Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack“ stand.
Alexandria Ocasio-Cortez (2021): Die Politikerin trug ein weißes Kleid mit dem Statement „Tax the Rich“ zur Met Gala, einem der bekanntesten Mode-Events der Welt.
Aber bei Kleidung geht es nicht nur darum, zu repräsentieren, Mode sei interaktiv, „eine ständige Verarbeitungsmaschine, die viel aufnimmt, viel aufsaugt und deswegen auch in Vorschläge verwandelt.“ Giannone betont, dass Kleidung nicht nur etwas zum Ausdruck bringt, sondern diesen auch selbstständig schafft. Etwa, indem sie unser Verhalten, unsere Bewegungen oder unser Verhältnis zu anderen mitprägt. Historisch, so Giannone, seien über Kleidung schon immer bestimmte Rollenbilder erzeugt worden, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht und Macht. „Ich kann mir keinen Geschlechtsstereotyp ohne Kleidung, ohne die Intervention von Kleidungszeichen vorstellen.“ Deshalb sei diese nicht nur ein Mittel der Darstellung, sondern auch selbst ein machtvolles Instrument. Giannone spricht von einer „Agency“ der Kleidung, einer eigenen Handlungsmacht.
Diese Handlungsmacht ist kein Phänomen der Gegenwart allein. Immer wieder wurde Mode genutzt, um Haltung zu zeigen, Zugehörigkeit auszudrücken oder sich bewusst von gesellschaftlichen Normen abzusetzen. Sie markierte die Differenz: zwischen Generationen, zwischen Gesellschaftsklassen, zwischen Zustimmung und Kritik. Und auch wenn sich Formen und Bedeutungen verschieben, bleibt ein Muster erkennbar. Mode war und ist immer wieder Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzung. „Das ganz klassische Beispiel ist die Französische Revolution. Die gilt als Paradebeispiel von einer Umkehrung der Regeln der Kleidung und der Rolle der Klassen in einer Gesellschaft“, so Giannone. Während Kniebundhosen damals zum gesellschaftlichen Standard gehörten, griffen die Revolutionäre bewusst zu langen Hosen, die bislang höchstens Arbeitskleidung gewesen waren. Sie inszenierten diesen Bruch sichtbar, ihr neues Kleidungsstück wurde zum Symbol für soziale Umkehr. Was damals eine klare politische Haltung markierte, wurde später vom Bürgertum übernommen und irgendwann ganz selbstverständlich. Heute denkt bei einer langen Hose kaum jemand an Revolution.
Politische Modetrends im 20. Jahrhundert
68er-Bewegung (1960er): Cordhosen und lange Haare bei Männern als Protest gegen Konformität
Hippies (1960er/70er): Schlaghosen und Flower-Power gegen Konsum und Krieg
Punks (ab 1970er): Irokesenschnitt und Nieten als Provokation
Blueser (1980er): Shell-Parkas und Tramper als Regime-Widerstand
Popper (1980er): Weiße Jeans und Kaschmirpulli als zelebrierte Konsumlust
Zeichen setzen, Zeichen tragen
Gerade junge Menschen nutzen Mode wieder zunehmend, um sich politisch, gesellschaftlich oder persönlich zu positionieren. Im gegenwärtigen Umgang damit hat sich viel verändert. Nicht nur was Stil oder Symbolik betrifft, sondern vor allem in der Art und Weise, wie junge Menschen sich mit Kleidung auseinandersetzen. Ein neues Verantwortungsgefühl hat sich entwickelt, so Antonella Giannone: „Mittlerweile weiß jeder, dass Kleidung beispielsweise auch mit Umweltverschmutzung verbunden ist und dass bestimmte Kaufverhalten als unverantwortlich betrachtet werden können. Das sind Sachen, die vor einigen Jahren keine so große Rolle gespielt haben. Es ist auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein entstanden.“ Die Entscheidung für ein Kleidungsstück ist somit auch eine Frage des Konsums, der Produktionsbedingungen und der ethischen Verantwortung. Viele junge Menschen begreifen Kleidung heute als Teil ihrer Haltung zur Welt. Die Entscheidung für bzw. gegen bestimmte Marken oder Second-Hand-Kleidung kann dabei ebenso eine Haltung ausdrücken, wie die Wahl eines Outfits, das bewusst Geschlechternormen bestärkt oder bricht. Zugleich ist Kleidung allgegenwärtiger als je zuvor. „Wir sind praktisch von Kleidung umgeben, im Vergleich zu anderen Epochen besitzen wir einfach sehr viel mehr davon. Und wir finden natürlich Wege, diese Objekte mit uns in Verbindung zu setzen und dann in unserer Art und Weise zu protestieren.“ Wir besitzen mehr, wir sehen mehr und wir zeigen uns selbst mehr. In einer digital geprägten Gesellschaft, in der jede:r via Social Media präsent ist, wird der eigene Körper zur Projektionsfläche. Diese ständige Sichtbarkeit macht Kleidung nicht automatisch politisch, aber sie schafft Raum für Interpretationen und Reaktionen. Schließlich verlangt die heutige Medienlogik eine ständige Aktualisierung politischer Zeichen. „Man ist quasi immer wieder gezwungen, etwas Neues zu erfinden“, sagt Giannone, da die Modeindustrie kulturelle Symbole rasch kommerzialisiert. Kleidung muss sich also immer neu aufladen, um politisch wirksam zu bleiben.
„Über die Kleidung, über den Körper hat man schon immer – gewollt oder ungewollt – auch eine politische Dimension des sozialen Daseins zum Ausdruck gebracht.“ Es ist nicht immer alles geplant. „Das ist oft eine Mischung aus individuellen Wünschen, individuellen Anliegen und kollektiven Erfahrungen.“ Wie wir uns kleiden, hat nicht nur mit Vorlieben und politischen Botschaften zu tun, Kleidung strukturiert auch soziale Räume. „Über Kleidung, also über sichtbare Zeichen, findet man auf jeden Fall Zugang zu Gruppen“, so Giannone. Diese Form der Zugehörigkeit funktioniere nicht nur durch das, was sichtbar gemacht wird, sondern auch durch das, was man bewusst vermeidet. Kleidung unterstützt damit Prozesse von Sozialisation. „Man entscheidet auch über die Kleidung, mit wem man assoziiert werden möchte und von wem man sich distanziert.“
Diese Entscheidungen bewegen sich nicht im luftleeren Raum, Kleidung ist eingebettet in gesellschaftliche Aushandlungen. Fortschritt und Rückschritt verlaufen dabei nicht linear. Giannone spricht von einem „ständigen Spannungsfeld“, in dem sich Emanzipation immer wieder neuen Gegenbewegungen stellen muss. Auch die Mode zeige das. Während Diversity-Kampagnen mehr Sichtbarkeit für verschiedene Körper versprachen, kehrten gleichzeitig klassische, westlich normierte Schönheitsideale auf die Laufstege zurück. Das Festhalten an bestimmten Bildern von Schönheit sei dabei nicht neutral, es markiere oft eine konservative Haltung. Kleidung, die dagegen alternative Körperbilder sichtbar macht, könne eine politische Gegenerzählung erzeugen. Mode, so Giannone, sei nicht nur Spiegel, sondern Vorausnahme. Trends zeigen, was gesellschaftlich möglich wird. Kleidung kann Entwicklungen andeuten, „die vielleicht für eine mögliche nahe Zukunft stehen“. Gerade in einer komplexen, instabilen Gesellschaft werde Kleidung wieder politisch gelesen. Nicht zwingend parteipolitisch, aber als Ausdruck einer Haltung zur Welt, zur Kollektivität und zur eigenen Position darin.

Almedina und Valerie | Quelle: Lukas Rentz
„Und was siehst du in mir?“
Draußen hat sich die Nachmittagssonne über die Altstadt gelegt, als Almedina und Valerie das erste Mal voreinander stehen. Zwei junge Frauen, zwei Stile, zwei Arten, sich zu zeigen und trotzdem wirkt es nicht gegensätzlich. Valerie schaut zu Almedina, ein Blick bleibt an der Brille hängen, an den Haaren. „Total ausdrucksstark“, sagt sie später. Almedina wiederum war gleich Valeries Ausstrahlung aufgefallen, positiv und einladend. Und ihre Schuhe: „Sehr cool kombiniert!“ Auch wenn sie sich für unterschiedliche Dinge interessieren, scheint da ein gemeinsames Interesse an Ausdruck, an Wirkung zu sein. Was Kleidung bedeutet, darüber denken beide nach, nur eben aus unterschiedlichen Richtungen. Zwischen ihnen steht kein Urteil, eher eine vorsichtige Neugier. Während Valerie wissen will, wie sich Almedina in der Mode orientiert, interessiert Almedina, was Weiblichkeit für Valerie heißt. Und beide fragen sich, wie die Andere ihre Kleidung nutzt, um sich auszudrücken. Die Fragen stehen unausgesprochen im Raum, sie müssen nicht dieselben sein, um nebeneinander Platz zu haben.
Was bleibt, ist das Gespräch. Nicht nur zwischen ihnen, sondern auch zwischen Normen und Brüchen, zwischen dem, was Mode zeigt, und dem, was sie sagen kann. Im besten Fall bleibt Kleidung nicht nur Oberfläche, sondern wird zu einer Einladung: sich zu zeigen, sich zu hinterfragen und sich zu positionieren.

Lea Pfaffmann & Johanna Richardt
Unser Projekt hat uns gezeigt, wie unterschiedlich Menschen mit Mode umgehen und dass darin mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht.