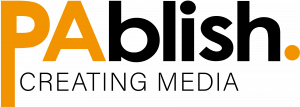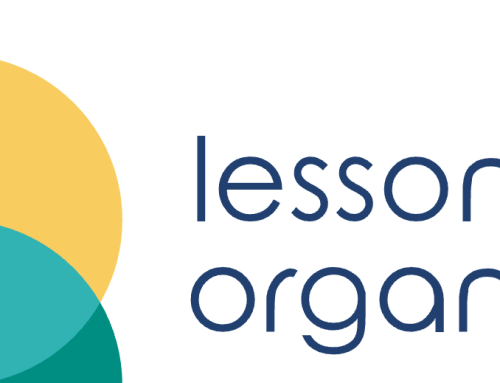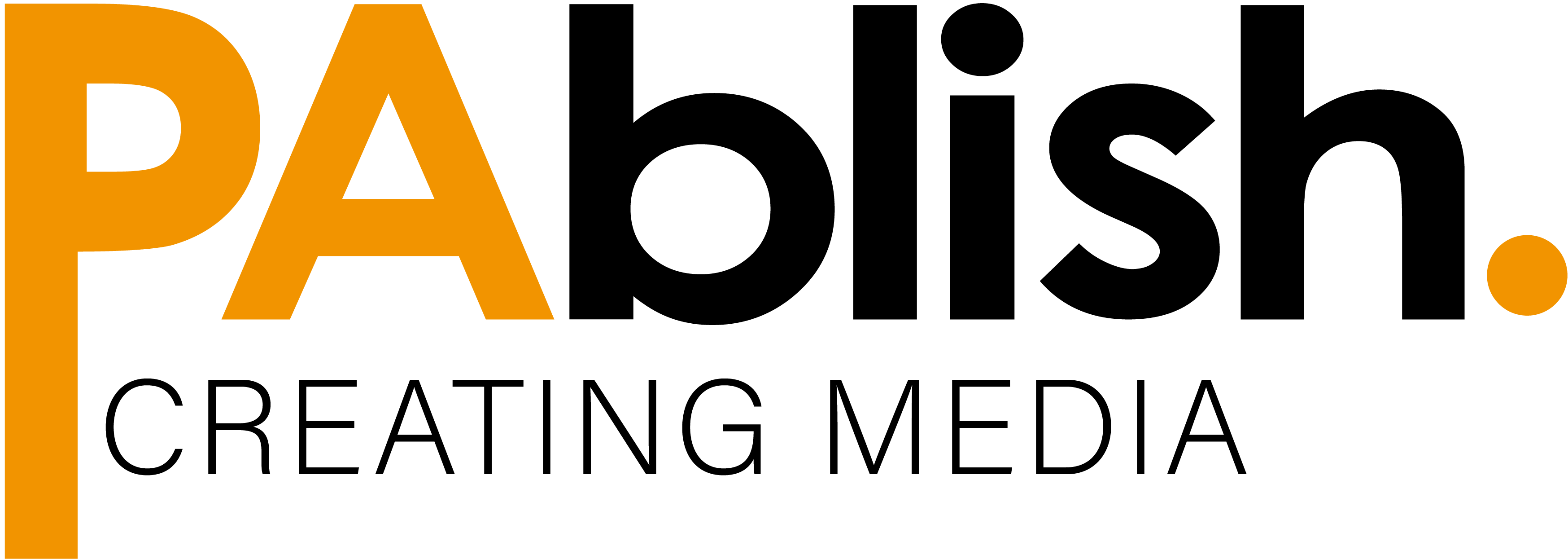Rechts liegen gelassen
Private Täterorte sind unbequem. Die Grausamkeit dieser Orte ist kaum greifbar. Und doch sind sie untrennbar mit den Gräueln des Nationalsozialismus verbunden. Drei dieser Orte erzählen ihre Geschichte.
von Julian Dettenhofer und Rahel Ullmann

Die Wächterhäuschen von Carinhall (Foto: Julian Dettenhofer)
Es gibt keinen Wegweiser. Erst nach dem Abbiegen auf eine Nebenstraße ist ein zugewucherter Stein erkennbar. Carinhall 3,8 Kilometer. Jemand hat die Inschrift ausradiert.
Gut sechzig Kilometer nördlich von Berlin liegt die Schorfheide. Auf den ersten Blick ein friedlicher Ort. Doch wer tiefer in den brandenburgischen Forst vordringt, betritt einen Schauplatz deutscher Geschichte. Einzig zwei kleine Wächterhäuschen sind noch erhalten. Sonst zeugen lediglich vereinzelte Fundamentreste, vermooste Rohre und Brocken von Mauergestein von der Vergangenheit des Ortes. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier vor nur etwas mehr als achtzig Jahren noch ein mächtiges Gebäude stand. Inmitten des dichten Waldes, idyllisch zwischen zwei Seen gelegen, lag Carinhall – benannt nach Hermann Görings verstorbener Ehefrau. Eine Mischung aus Jagdschloss und Repräsentationsbau. Aber vor allem ein Ort der Selbstinszenierung. Die Architektur war monumental, die Innenräume opulent ausgestattet. Mehr als 4000 Gemälde und Kunstgegenstände schmückten Carinhalls Wände, Säulen und Plastiken säumten die zugehörige Parkanlage. Heute lässt sich das Ausmaß dieses Prunkbaus nur noch erahnen.
1933 ließ sich Göring hier nieder. Als Reichstagspräsident und Hitlers rechte Hand stellte die Regierung ihm insgesamt 1000 Hektar Land zur Verfügung, um sich einen repräsentativen Landsitz im Grünen errichten zu lassen. Umgeben von geraubter Kunst bereitete Göring hier den Überfall auf Polen vor, koordinierte die Angriffe der Luftwaffe und war direkt an der „Endlösung der Judenfrage“ beteiligt.
Kurz vor Kriegsende ließ er das Anwesen von der Luftwaffe sprengen. Wer sich heute ein Bild davon machen möchte, muss gezielt danach suchen. Man überließ das Gelände hier weitgehend sich selbst und mit Carinhalls Grundriss verblasst auch seine Geschichte. An anderen Orten ist sie geblieben.

Himmlers Villa am Tegernsee - heute ein Hotel (Foto: Rahel Ullmann)
In Gmund am Tegernsee steht noch heute die ehemalige Villa Heinrich Himmlers, seinerzeit Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei. Mittlerweile befindet sich darin ein Hotel. Wo heute Tourist:innen den Blick auf das Wasser und die Alpen genießen, in der Sauna schwitzen oder durch die großzügige Parkanlage flanieren, lebte einst einer der einflussreichsten und brutalsten Nationalsozialisten. Die Villa Lindenfycht war das Zuhause von Himmler und seiner Familie, weit entfernt vom Machtzentrum in Berlin und doch eng verknüpft mit den Verbrechen des NS-Regimes.
Himmler verfügte über enorme Macht und gestaltete aktiv den Terrorapparat des Nationalsozialismus mit. Die willkürliche Verfolgung politischer Gegner:innen durch Gestapo und SS, der Ausbau des KZ-Systems, die Deportation und Ermordung von Millionen von Jüd:innen, Zivilist:innen und Kriegsgefangenen – all das plante und organisierte das NS-Regime systematisch unter Himmlers Aufsicht.
In Himmlers Wohnzimmer hängen heute Bilder von südafrikanischen Transfrauen. Ein absoluter Kontrast zum Vorbesitzer der Villa. Wo man früher die Verfolgung und Tötung von Millionen von Menschen entschieden hat, stehen heute Lachsforellen-Sashimi und Beeftatar auf der Speisekarte. Doch das Blyb-Hotel bemüht sich um Aufarbeitung. Eine große Informationswand im Eingangsbereich erzählt die Geschichte des Hauses, regelmäßig finden Workshops mit Schulen der Region statt.
Während man hier versucht, die Vergangenheit kreativ und reflektiert in den Alltag der Menschen einzubetten, arbeitet man sie an anderen Orten professionell auf. Ungeschönt, dokumentarisch und institutionalisiert.

Die Dokumentation Obersalzberg von außen (Foto: Rahel Ullmann)
Der Obersalzberg in den Berchtesgadener Alpen ist ein solcher Ort: Einst einer der wichtigsten Rückzugsorte Adolf Hitlers, heute ein Ort des Lernens und Erinnerns.
Schon in den 1920er Jahren besuchte Hitler die Gegend, ab 1933 ließ er den Berghof zu seinem zweiten Regierungssitz ausbauen. Auf dem Areal entstand das abgeschirmte Führersperrgebiet. Auch andere hochrangige Nationalsozialisten wie Martin Bormann, Albert Speer oder Hermann Göring bauten sich in unmittelbarer Nähe Wohnhäuser. So entwickelte sich der Obersalzberg zu einem Zentrum nationalsozialistischer Macht.
Hitler nutzte diesen Ort bewusst für seine Propaganda. Im schönen Alpenpanorama entstanden vermeintlich private Schnappschüsse, die in erster Linie den Führerkult befeuern sollten. Doch der Obersalzberg war nicht nur Urlaubsort, hier entschied man über Verfolgung, Krieg und Völkermord.
Der Weg dorthin ist heute gut ausgebaut und beschildert. Die Straße ist asphaltiert und es gibt einen Parkplatz. Die Dokumentation Obersalzberg, ein Zentrum für Aufklärung über den Nationalsozialismus in der Region, befindet sich in einem modernen Gebäude, das seit 2023 neu eröffnet ist. Die Dauerausstellung „Idyll und Verbrechen“ setzt sich mit dem Gegensatz der Berglandschaft und den Schrecken der NS-Zeit auseinander und erzählt vom Schicksal der Opfer. Die Dokumentation informiert nicht nur, sie entmystifiziert auch: den Personenkult, die Inszenierung, den touristischen Sog des Ortes.
Orte, an denen Täter:innen lebten und über Leben entschieden, sind schwer einzuordnen. Sie provozieren Fragen: Darf man auf den Überresten von Görings Anwesen spazieren gehen? Kann man in Himmlers Schlafzimmer übernachten? Muss die Erinnerung an Hitler institutionalisiert sein, damit man sie ernst nimmt?
Deutschland gilt als Land der Erinnerung. Mahnmale und Stolpersteine gehören in das Bild vieler Städte. Es gibt über 300 Gedenkstätten und Dokumentationszentren. Das Grundgesetz selbst ist eine demokratische Antwort auf Deutschlands nationalsozialistische Vergangenheit. Und doch entsteht der Eindruck: Je mehr man nach aktiver Erinnerungskultur sucht, desto weniger findet man. In einem Artikel der Deutschen Welle vom 27. Januar 2025 liest man folgendes Zitat von Veronika Hager, wissenschaftliche Referentin des Vorstands der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ): „Fast alle Gedenkstätten sind konfrontiert mit Vandalismus und Holocaustleugnung.“ Und noch dazu: Während Konzentrationslager und Hinrichtungsstätten fest in die kollektive Erinnerung eingebunden sind, bleiben viele andere Orte unsichtbar. Private Täterorte – die ehemaligen Wohnsitze und Rückzugsräume von NS-Funktionären – finden keinen Platz mehr im kulturellen Gedächtnis der Deutschen. Diese Orte, wie Görings Carinhall, Himmlers Villa Lindenfycht am Tegernsee oder Hitlers Berghof, sind keine reinen Kulissen. Sie waren Schauplätze von Machtausübung, Selbstinszenierung und strategischer Planung der schlimmsten Kriegsverbrechen. Hier entstand ein Stück Zeitgeschichte. Und dieses Stück ist nicht wichtiger oder unwichtiger als die Geschichte anderswo, sondern schlichtweg anders. Dennoch spielen diese Orte selten eine Rolle. Und wenn, dann eine vage und unbequeme.
Die deutsche Erinnerungskultur ist schwierig. Die Privaträume der Täter:innen verdeutlichen dies noch deutlicher als andere Orte. Häufig fehlt hier eine konsequente Aufarbeitung. Das mag daran liegen, dass sie nicht in das vertraute Schema von Schuld und Trauer passen. Jedoch geht es hier nicht um das Gedenken an Leid, sondern um die Frage nach Verantwortung. Gerade deshalb sind diese Orte besonders wichtig. Sie zeigen: Nicht nur in Lagern und Ministerien plante man die NS-Verbrechen, sondern auch in Wohnzimmern mit Seeblick und auf Terrassen mit Alpenpanorama. Das Regime missbrauchte die Idylle als Teil der Inszenierung.
Erinnerung muss nicht unbedingt monumental sein. Sie muss auch nicht laut oder imposant oder aufwändig sein. Wichtig ist nicht die Form, sondern das Bewusstsein, dass auch die Privaträume der Täter:innen ein Teil der kollektiven Geschichte Deutschlands sind. Wenn selbst an so symbolisch aufgeladenen Orten das Erinnern Glückssache ist, wenn sogar dort, wo Hermann Göring die „Endlösung der Judenfrage“ plante, das Gedenken schwerfällt, sendet das ein deutliches Signal: Dass man Vergangenheit dort, wo sie unbequem ist, doch wieder an den Rand drängt.
Täterorte sind keine leeren Orte. Sie sind Orte des Aushandelns. Zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Schuld und Verantwortung, zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre. Wie wir mit ihnen umgehen, verrät mehr über unsere Gegenwart als über unsere Vergangenheit.
Es braucht also Klarheit. In einer Zeit, in der rechte Strömungen wieder aktiv daran arbeiten, die Geschichte in ihrem Sinne zu verzerren, ist die Erinnerung umso wichtiger. Sie betrifft unsere demokratische Gegenwart. Und unsere Zukunft.

Julian Dettenhofer & Rahel Ullmann
Durch die Beschäftigung mit den Landsitzen der NS-Elite können wir jetzt mit einem neuen Blick auf die deutsche Erinnerungskultur schauen. Wir haben gelernt, dass es nicht den einen richtigen Weg im Umgang mit diesen Orten gibt, sondern dass verschiedene Ansätze zum Ziel führen können.