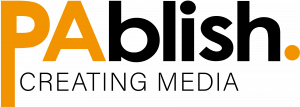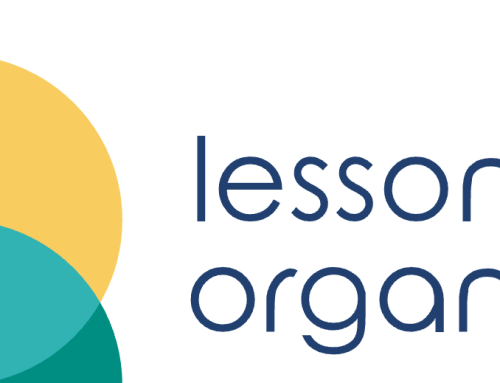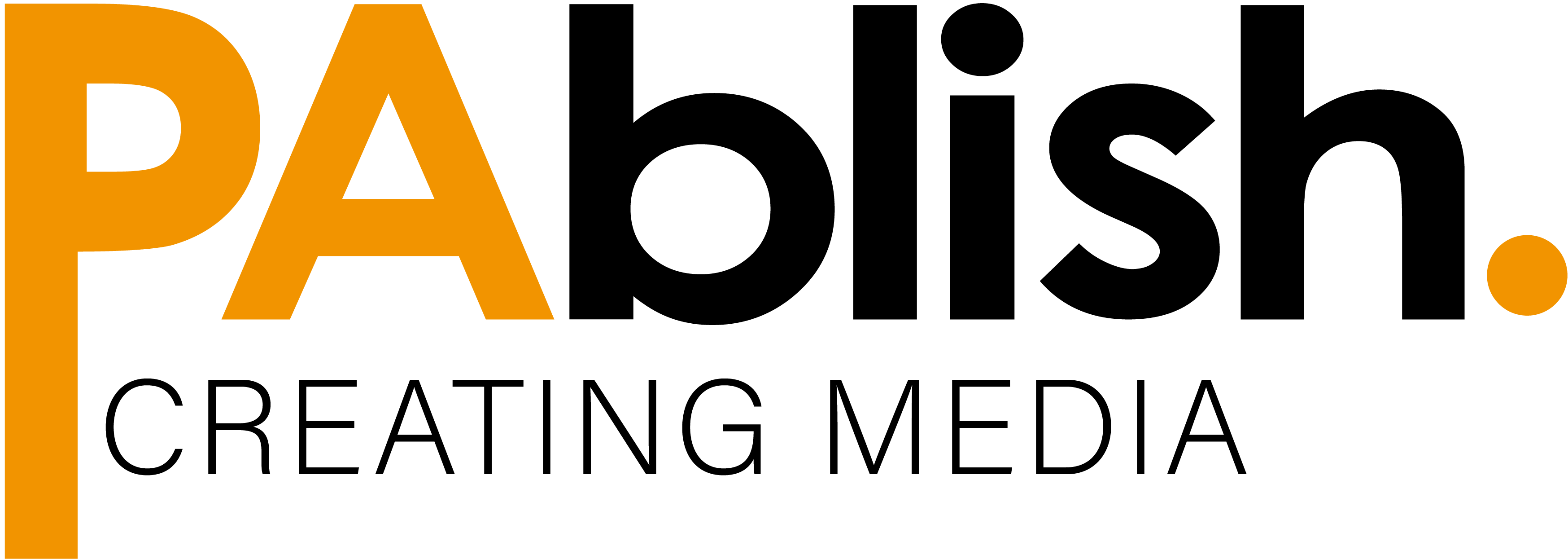Zwischen Himmel und Höhle
Extremsport – das klingt nach Testosteron, Tempo, Tollkühnheit. Nach Adrenalinjunkies, die sich ohne Rücksicht auf Verluste irgendwo hinunterstürzen oder abtauchen. Hoch oben oder tief unten, Hauptsache Gefahr. Doch stimmt dieses Bild überhaupt? Was, wenn Extremsport gar nicht extrem ist – zumindest nicht im klassischen Sinn, sondern leise, kontrolliert, fast meditativ? Was, wenn es weniger um Wahnsinn geht als um Kontrolle? Weniger um Nervenkitzel als um innere Ruhe?
von Salma El Mesmoudi und Max Kienast

Bernhard im Diver's Indoor Tauchsportzentrum | Quelle: Salma El Mesmoudi
Zwei Menschen, die sich freiwillig in Situationen begeben, die den meisten von uns verborgen bleiben, sind Cid und Bernhard. Cid springt mit dem Fallschirm von Brücken und Türmen. Bernhard taucht in stockfinstere Höhlensysteme – teils kilometerweit unter der Erde. Zwei unterschiedliche Leben, zwei verschiedene Elemente. Und doch verbindet sie mehr, als man denkt.
Cid – Absprung ins Unbekannte?
Cid steht auf einer 141 Meter hohen Brücke in Südfrankreich. Unter ihr: Luft, Leere, Gras. Über ihr: nichts als Himmel. Um sie herum stehen ihr Lehrer und die anderen Schüler:innen. Es sind ihre ersten Basejumps. Der Wind ist ruhig, das Rig sitzt – so nennt man das Fallschirmsystem im Fachjargon. Ein Schritt trennt sie vom freien Fall. „Die ersten fünf Sprünge haben mich echt Überwindung gekostet“, sagt sie später. „Ich habe mich gefragt: Was mache ich hier eigentlich?“

Basejumperin Cid nach einem erfolgreichen Sprung | Quelle: Cid
Was sie da macht, ist nicht zufällig. Cid, 35, hat Kunst, Medien und Philosophie studiert. Heute lebt sie in Oldenburg, arbeitet im Schichtdienst bei der Bahn – und steckt jede freie Minute, jeden Cent in ihren Sport. Vor zwei Jahren hat sie mit Fallschirmspringen angefangen. Mittlerweile hat sie knapp 500 Sprünge hinter sich – sehr viel für so einen kurzen Zeitraum. „Ich habe keine Familie, keine Verpflichtungen. Ich lebe für diesen Sport.“ Dass sie irgendwann beim Basejumpen landet, war eher Zufall.
„Ich mochte eigentlich immer den freien Fall beim Fallschirmspringen – und der ist beim Basen ja sehr kurz“, sagt sie und lacht. Trotzdem ist sie „hängen geblieben“. Vielleicht gerade, weil Basejumping mehr Disziplin als Freiheit verlangt. „Du hast keinen Spielraum. Einen Schirm, keine Reserve, keine Fehlerzeit.“ Wenn sie vom Springen spricht, geht es nicht um Mut oder um Heldentum. Es geht um Präzision. Um Material, um Packmethoden, Auslösemechanismen, Luftströmung. Fast schon liebevoll zeigt sie ihr Rig, erklärt, wie sich der kleine Hilfsschirm entfaltet, welche Rolle die sogenannten Pins spielen und warum ein BASE-Schirm anders gefaltet werden muss als ein Skydiving-Schirm. „Beim normalen Fallschirm dauert das Packen zehn Minuten“, sagt sie. „Beim Basen: mindestens 45. Und das auch nur, weil ich’s schon hundertmal gemacht habe.“
Was bedeutet BASE?
BASE ist ein Akronym:
Building (Gebäude) Antenna (Funkmast) Span (Brücke) Earth (Fels/Klippe)
Basejumping ist das Fallschirmspringen von festen Objekten. Der geringe Abstand zum Boden macht es besonders gefährlich.
„Angst? Nee. Höchstens Respekt.“ Cid beschreibt eine Ruhe, die sie vor dem Sprung durchströmt: Sie sei total fokussiert, denke nur noch daran, alles andere sei ausgeblendet. Eine Haltung, die Sportpsychologin Carolin Krupop kennt. „Menschen, die Extremsport auf hohem Niveau betreiben, sind in der Regel keine Adrenalinjunkies“, sagt Krupop. „Sie haben gelernt, das Risiko zu verstehen und zu minimieren.“ Was Cid beschreibt, ist typisch für viele Extremsportler:innen, sagt die Sportpsychologin. Es gehe nicht darum, Angst zu besiegen – sondern darum, mit ihr zu leben, mit ihr umzugehen. Die Grenze zwischen Nervosität und Respekt sei oft eine Frage der Erfahrung.
Bernhard – Die Tiefe gehört niemandem
Bernhard kennt diese Grenze gut. Seit mehr als 30 Jahren taucht er, zuerst als Rettungsschwimmer, später als technischer Tief- und schließlich als Höhlentaucher. Genau wie Cid springt er in die Tiefe. Allerdings taucht er in sie hinein. Langsam, gleichmäßig, mit geschlossenem Kreislaufsystem auf dem Rücken, das verbrauchte Luft wieder aufbereitet. Was er dabei sucht, kann er kaum in Worte fassen und vielleicht genau deshalb tut er es.
Bernhard steht nicht auf Plattformen. Er verschwindet darunter. Höhleneingänge, oft kaum einen Meter hoch, manchmal versteckt in Flussbetten oder zwischen Felsen, sind seine Tore in eine andere Welt. Wenn er in der Höhle ist und die geschlossene Decke über ihm, „ist es eine absolute Ruhe, es gibt nichts mehr. Das ist für mich Entspannung pur.“ Bernhard ist 48 Jahre alt, geboren am Starnberger See, früh zur Wasserwacht gegangen, später Tauchlehrer, Ausbilder und Entwickler von Spezialausrüstung. Wer mit ihm spricht, merkt schnell:

Cavediver Bernhard mit Kreislaufsystem beim Training | Quelle: Salma El Mesmoudi
Das hier ist kein Hobby – das ist Passion – vielleicht sogar mehr als das. „Alle drei, vier Monate beginnt irgendwas in mir zu rufen, und dann muss ich die Sachen packen und muss irgendwo in einer Höhle tauchen und dann ist es auch wieder gut.“
Sein Alltag spielt sich heute im Allgäu ab, beruflich leitet er die Qualitätskontrolle in einem Industriebetrieb. Tauchen ist „nur noch“ ein Hobby – und das aus gutem Grund: „Wenn du musst, verlierst du den Spaß. Ich will tauchen, weil ich will – nicht weil ich muss.“ Seine Tauchgänge führen ihn und seine Tauchpartner:innen tief in Systeme wie die Emergence du Ressel in Frankreich oder die Cueva del Agua in Spanien. Kilometerlange Gänge, manche nie zuvor beschwommen. Bernhard spricht von Stille. Von Räumen, in denen der eigene Herzschlag zur einzigen Geräuschquelle wird. Von zehn Stunden unter Wasser. Von der totalen Konzentration. „Wenn jemand vor einem Tauchgang laut ist, dann stimmt was nicht. Bei uns redet keiner. Wir checken, jeder für sich. Und wenn der Bauch Nein sagt – dann ist Nein.“
Was ist mit Leine legen gemeint?
Taucher legen bei Höhlentauchgängen eine Führungsleine, um jederzeit sicher den Rückweg zum Ausgang zu finden. Ist noch keine Leine vorhanden, wird eine neue gelegt – ohne Leine taucht niemand in unbekannte oder unübersichtliche Bereiche.
Respekt – dieses Wort fällt oft. „Angst darf keinen Platz haben“, sagt er, „weil sie lähmt“. Fehler verzeiht die Tiefe nicht. Bernhard spricht von drei tödlichen Unfällen in den letzten zwei Jahren – alle aus demselben Grund: zu wenig Sauerstoff. Keine technischen Defekte, keine wilden Manöver. „Einmal nicht genau gecheckt. Flasche nicht richtig aufgedreht. Dann ist es zu spät.“
Im Basejumping sind die Todesfallzahlen noch höher, und dokumentiert: Denn trotz der hohen Sicherheitsstandards und der intensiven Vorbereitung gilt: Basejumping ist gefährlich. Die sogenannte BASE Fatality List zählt inzwischen über 547 dokumentierte Todesfälle weltweit. Im Juni allein sind vier Männer gestorben, darunter ein 19- und ein 24-jähriger.
Zwischen Risiko und Ruhe – Was Extremsport mit uns macht
Menschen wie Cid und Bernhard treibt es hinein in die Luft, hinein in die Tiefe – an Orte, wo andere längst umkehren. Erklärungen dafür finden sich auch in der Psyche. Die Sportpsychologin Carolin Krupop begleitet Menschen, die sich freiwillig in extreme Situationen begeben – körperlich wie mental. Für sie ist klar: Die typischen Klischees vom risikosuchenden Draufgänger greifen zu kurz. „Es ist identitätsstiftend“, sagt Krupop. Sich einer Community zugehörig zu fühlen, ist wichtig, denn viele Extremsportarten werden innerhalb von Gemeinschaften ausgeübt. Im Kern hat Extremsport keinen Wettkampfcharakter. Es geht vielmehr darum, ganz bei sich zu sein, in Interaktion mit der Natur, präsent im Moment. „Und wenn man sich das nötige Fähigkeitsniveau angeeignet hat, um diese Sportarten ausüben zu können, dann erlebt man sehr besondere Momente.“
In einer Gesellschaft, die zunehmend auf Sicherheit und Planbarkeit setzt, erscheinen Extremsportarten wie ein Gegenentwurf. Es geht um Autonomie – auch gegenüber einer Welt, die viele Risiken externalisiert hat. Extremsport ist in diesem Sinne nicht Eskapismus, sondern Selbstermächtigung. Eine Art kontrollierter Kontrollverlust in einer überversicherten Welt.
„Keine Ablenkung, keine Nebengeräusche. Nur Handlung und Wahrnehmung“, sagt Krupop. Psychologisch nennt man das Flow – ein Zustand völliger Fokussierung, den viele Extremsportler:innen beschreiben. Wer so etwas erlebt, sucht es wieder. Nicht aus Sucht, sondern aus Bedeutung – und immer mit dem nötigen Respekt – das zentrale Bindeglied zwischen Cid und Bernhard. Beide sprechen nicht von Angst, aber von Achtsamkeit. Von präzisen Routinen. Von dem Wissen, dass ein Fehler genügt. Und davon, wie genau dieses Wissen sie ruhig macht. Beide relativieren das Risiko ihres Sports mit demselben Vergleich: Im Straßenverkehr, sagen sie, sei die Gefahr viel größer – weil man sie dort nicht selbst kontrollieren kann.
Entgegen der vielleicht gängigen Annahme kommt Kritik an Cids Sport nicht von außen – sondern vor allem aus der eigenen Community. Es seien besonders die „normalen“ Fallschirmspringenden, die sie an den Dropzones, den Absprungzonen, fragen, wieso sie sich dieser Gefahr aussetzt. Aber vielleicht auch, weil sie das Risiko besser kennen als die eher faszinierten Außenstehenden. Bernhard hat alles schon gehört. Bewunderung sowie Kritik an seiner Passion. Nicht jedoch aus der eigenen Familie. „Meine Partnerin taucht selbst in der Höhle und meine Tochter ist auch schon ein paar Mal getaucht. Aber das lasse ich einfach so laufen. Entweder sie will das irgendwann weitermachen oder nicht. Das handhabe ich relativ locker.“
Freiheit mit Einschränkungen – Wie legal ist das Extreme?
Wo es psychologisch um Selbstverantwortung geht, beginnt juristisch oft der Konflikt: Extremsportarten wie Basejumping und Cave Diving bewegen sich nicht nur physisch an Grenzen – sondern auch rechtlich. In Deutschland gibt es dafür keine klaren gesetzlichen Verbote, aber zahlreiche Einschränkungen, die ihre legale Ausübung erschweren oder faktisch verhindern.
Basejumping fällt unter das Luftverkehrsgesetz. Für Sprünge von Bauwerken oder natürlichen Formationen sind luftverkehrsrechtliche Erlaubnisse erforderlich. Zusätzlich muss die Eigentümer:in des Absprungorts zustimmen. Malte Stemkowitz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sicherheitsrecht an der Universität Passau, betont dass diese Verfahren stark vom Ermessen der zuständigen Behörden abhängen würden. Faktoren wie die konkrete Gefahrenlage, das öffentliche Interesse oder auch der bisherige sicherheitsrechtliche Umgang mit Basejumping beeinflussen die Entscheidung. Das Ergebnis: Auch wenn es theoretisch möglich ist, ist es in der Praxis kaum realisierbar. Mit Ausnahme eines legalen Events bei Dresden versucht Cid es deshalb erst gar nicht.
Das bedeutet: Ausweichorte im Ausland. „Es wäre cooler, wenn irgendwas hier in der Nähe wäre, wo man wirklich legal springen könnte. Es ist immer mit hohen Kosten verbunden, wenn man ins Ausland fahren muss, um da springen zu können. Gerade die Schweiz – das Mekka für Basejumping – ist nicht günstig und von Norddeutschland echt weit entfernt.“
Auch das Höhlentauchen ist nicht bundeseinheitlich geregelt. Zwar existiert kein gesetzlicher Tauchscheinzwang, doch viele der betauchbaren Höhlensysteme unterliegen anderen Bestimmungen: Naturschutzauflagen, Eigentumsrechte, lokalen Zugangsregelungen oder wie Bernhard es nennt: „Vereinsmeierei“. Er taucht deswegen häufig im Ausland, zuletzt auf Sardinien, wo er einen Trip über acht Kilometer und fünf Stunden absolvierte.
Zwar garantiert Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes die allgemeine Handlungsfreiheit, darunter fällt auch die Freiheit zur Selbstgefährdung. Doch sobald Dritte betroffen sind, etwa durch Rettungseinsätze, Umweltbeeinträchtigungen oder öffentliche Sicherheit, greifen gesetzliche Beschränkungen. Das Ergebnis: Extremsport bleibt in Deutschland nicht verboten, aber schwer zugänglich. Und genau das zwingt viele Sportler:innen wie Cid oder Bernhard ins Ausland – nicht, weil sie sich Regeln entziehen wollen, sondern weil es in Deutschland kaum Räume dafür gibt.
Weitermachen – So lange es geht
Cid und Bernhard können sich ein Leben ohne ihren Sport nicht vorstellen. Sie wollen selbst bestimmen, wann Schluss ist – und hoffen, dass es dann eine freiwillige Entscheidung ist. Bernhard „gibt es sehr viel innere Ruhe und Befriedigung“. Und auch Cid „war noch nie so zufrieden, wie in den letzten zwei Jahren“, seit sie springt. Denn vielleicht ist es genau das: Nicht das Extreme, das sie suchen. Sondern das Gefühl, ganz bei sich zu sein. Für einen Moment. Für ein paar Sekunden im freien Fall – oder für zehn Stunden unter Wasser.

Salma El Mesmoudi & Max Kienast
Durch unser Projekt hatten wir die Möglichkeit, Extremsport von vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und uns mit Klischees, Stereotypen und Wahrnehmung zu beschäftigen.