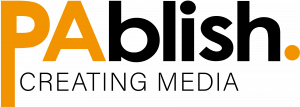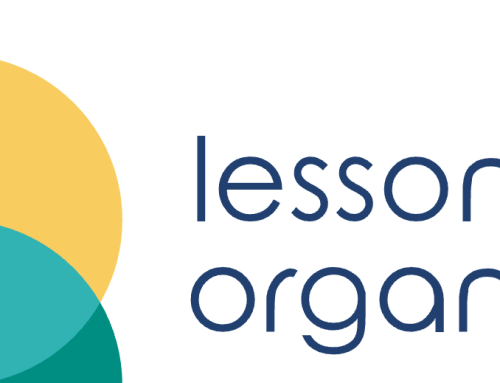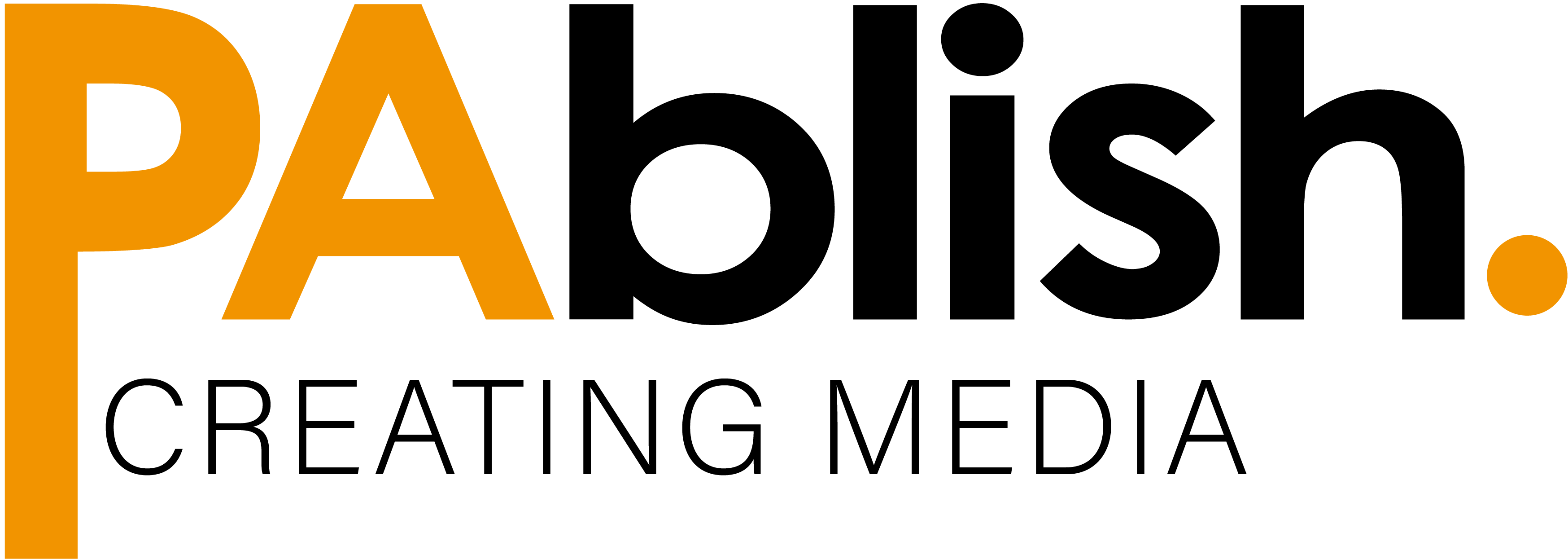Merle ist 20 Jahre alt, hat letztes Jahr ihr Abitur gemacht und arbeitet seit zwei Monaten als U+ Kraft an ihrer ehemaligen Schule. U+ Kräfte springen dann ein, wenn kein Lehrer den Unterricht leiten kann. Wer an der Schule als U+ Kraft arbeiten möchte, braucht ein Abitur und ein erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge. Fachliche oder pädagogische Qualifikationen sind nicht erforderlich.
Von Torill Bähring

„Wer jetzt noch redet, wird ins Klassenbuch geschrieben“, sagt Merle mit fester Stimme. Das unruhige Gebrabbel verstummt, die Sechstklässler blicken ehrfürchtig zu ihrer gerade mal acht Jahre älteren Lehrerin. Der Raum ist alt und abgenutzt. Die beschmierten Tische stehen in vier langen Reihen, die Regale an der Wand sind vollgestopft mit Ordnern, Mappen und Büchern. Plakate lösen sich von den Wänden, durch die kleinen Fenster fällt nur wenig Tageslicht. Die Röhrenlampen werfen ein kaltes Licht in den Raum. Wie so oft in Vertretungsstunden wurde auch heute kein Arbeitsauftrag hinterlassen. Die Schüler wollten Kahoot spielen, doch sie wurden zu unruhig. „Ihr seid zu laut, wir machen das jetzt aus.“ Merle muss improvisieren. „Ihr habt grad Brüche, oder?“ Einige Kinder nicken. Merle dreht sich um und schreibt sechs Brüche an die Tafel. „So, die kürzt ihr jetzt. Wer will anfangen?“ Drei Schüler melden sich.
Vor Kurzem drückte sie selbst noch die Schulbank
Merle war nach ihrem Abitur für ein paar Monate in Australien. Seit etwa zwei Monaten arbeitet sie nun als U+ Kraft an ihrer ehemaligen Schule. „Ich fand das früher immer richtig cool und dachte so: Ich will das auch irgendwann mal machen.“ Merle ist eine von 30 U+ Kräften an der Gesamtschule in Hessen. Durch den bundesweiten Lehrermangel können die Ausfälle in vielen Schulen nicht mehr mit festangestellten Lehrkräften aufgefangen werden. Die Gesamtschule hat den Status einer selbstständigen Schule, wodurch sie unabhängiger vom Schulamt ist. Dadurch konnte in den letzten Jahren noch einiges kompensiert werden. So wurde etwa ein Teil des Budgets in die Einstellung von U+ Kräften investiert. Merle konnte das Abizeugnis und ein erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorlegen – sie erfüllt damit alle geforderten Voraussetzungen.
 Was früher als Notlösung galt, ist heute Alltag. In jeder zweiten Schule konnte im Jahr 2023 mindestens eine Stelle nicht besetzt werden, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung zeigt. In 17 Prozent der Schulen fehlten sogar drei oder mehr Lehrkräfte. Die Folgen: Ausfall statt Unterricht, Überstunden statt Pausen. Klassen werden größer, Stundentafeln gekürzt. Wo keine Lehrkraft verfügbar ist, springen Quereinsteiger ein – mittlerweile an zwei von drei Schulen. Nicht selten unterrichten Personen ohne abgeschlossene Lehramtsausbildung.
Was früher als Notlösung galt, ist heute Alltag. In jeder zweiten Schule konnte im Jahr 2023 mindestens eine Stelle nicht besetzt werden, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung zeigt. In 17 Prozent der Schulen fehlten sogar drei oder mehr Lehrkräfte. Die Folgen: Ausfall statt Unterricht, Überstunden statt Pausen. Klassen werden größer, Stundentafeln gekürzt. Wo keine Lehrkraft verfügbar ist, springen Quereinsteiger ein – mittlerweile an zwei von drei Schulen. Nicht selten unterrichten Personen ohne abgeschlossene Lehramtsausbildung.
Der Mangel an qualifiziertem Personal gefährdet nicht nur die Unterrichtsversorgung, sondern auch die Qualität des Unterrichts. Die Auswirkungen sind messbar: Je weniger Unterricht stattfindet, desto schlechter schneiden die Schüler ab – vor allem jene aus sozial benachteiligten Familien. Zuhause fehlt oft die nötige Unterstützung. Der Lehrkräftemangel ist also nicht nur eine organisatorische Herausforderung, er beeinflusst auch die Chancengleichheit.
Klarer Arbeitsauftrag: Fehlanzeige
„Okay, ihr könnt zusammenpacken.“ 9:15 Uhr – erste große Pause. Die Gänge füllen sich, Stimmen hallen von den steinernen, hohen Decken. Merle schließt die Tür mit der bunten Aufschrift „G6b“ ab und wird mit der Menge zum Ausgang gespült. Über den betonierten Schulhof, vorbei an der Cafeteria, vor der sich eine mindestens drei Meter lange Schlange gebildet hat, ins Lehrerzimmer. Hier ist es ruhiger. Einige Lehrer unterhalten sich und trinken Kaffee aus Tassen mit Aufschriften wie „ABI 20“ oder „Klasse M10a“. Manche sitzen auf ihren Plätzen an den zusammengeschobenen Tischen, korrigieren Klassenarbeiten oder essen ihr Pausenbrot. An der Wand neben der Tür hängt ein kleiner Bildschirm, auf dem der Vertretungsplan angezeigt wird. Um ihn herum hat sich eine Traube Lehrer gebildet. Sie suchen ihren Namen in der zwei Seiten langen Tabelle – vielleicht hat sich kurzfristig etwas geändert.

Merle geht in den hinteren Raum zur Vertretungstheke. Der Tisch ist leer. Kein Arbeitsauftrag für die nächste Stunde. Sie verlässt das Lehrerzimmer schnell wieder. „Ist komisch mit den ehemaligen Lehrern“, sagt sie leise, als sie sich auf die Bank vor dem Schulgebäude setzt. Die Sonne strahlt auf den Schulhof. Eine Gruppe jüngerer Schüler wirft sich einen Tennisball über die Tischtennisplatte zu. Ältere Schüler stehen in kleinen Grüppchen am Rand des Schulhofs und unterhalten sich.
Für die festangestellten Lehrkräfte ist der Alltag mit U+ Kräften zur neuen Realität geworden. „Ohne sie könnten wir viele Stunden gar nicht mehr abdecken“, sagt eine erfahrene Lehrerin, während sie ihre Wasserflasche aufdreht. Dass ehemalige Schüler wie Merle jetzt selbst unterrichten, sieht sie pragmatisch. „Ich hab damit kein Problem“, sagt sie. „Manche Kollegen sehen das kritischer.“ Die Haltung eines Kollegen ist klar und deutlich. „Als ich nach der Vertretungsstunde wieder in die Klasse kam, hatte der Unterricht faktisch nicht stattgefunden.“ Er sieht im Einsatz von U+ Kräften ein großes Risiko. „Mangelnde Qualifikation“, sagt er knapp. Ob das Modell Zukunft hat? Für ihn nicht. „Das ist keine Lösung. Maximal eine Notlösung.“
„Ich verstehe die Aufgabe nicht“
14.500 unbesetzte Lehrerstellen – so viele Lehrkräfte fehlen aktuell in Deutschland, bestätigen die Kultusministerien der Länder. Und es wird nicht besser: Die Kultusministerkonferenz prognostiziert einen langfristigen Engpass. Bis 2035 werden voraussichtlich rund 49.000 Lehrkräfte fehlen, selbst wenn alle Lehramtsstudierenden ihr Studium abschließen.
 Merle ist auf der Suche nach Raum 1003. Wegen der steigenden Schülerzahlen brauchte die Schule mehr Platz. Letztes Jahr wurden Container angebaut. Mehr Schüler, weniger Lehrer. Merle geht die Außentreppe aus Stahl hinauf in den Klassenraum der G5. Es riecht noch neu, wie in einem Möbelhaus. Die Tische, Regale und Decken sind sauber und unbeschädigt. Die Fenster sind deckenhoch und lassen viel Licht herein. Dreißig Kinder sitzen an den Tischen, die U-förmig ausgerichtet sind. „Habt ihr Aufgaben bekommen?“, fragt Merle. Ein Junge holt sein Smartphone aus der Tasche. „Darf ich auf Teams schauen?“ – „Ja.“ Merle schreibt die Matheaufgaben an das neue Smartboard. Sie selbst kann nicht auf Teams zugreifen und muss sich in solchen Situationen auf die Schüler verlassen.
Merle ist auf der Suche nach Raum 1003. Wegen der steigenden Schülerzahlen brauchte die Schule mehr Platz. Letztes Jahr wurden Container angebaut. Mehr Schüler, weniger Lehrer. Merle geht die Außentreppe aus Stahl hinauf in den Klassenraum der G5. Es riecht noch neu, wie in einem Möbelhaus. Die Tische, Regale und Decken sind sauber und unbeschädigt. Die Fenster sind deckenhoch und lassen viel Licht herein. Dreißig Kinder sitzen an den Tischen, die U-förmig ausgerichtet sind. „Habt ihr Aufgaben bekommen?“, fragt Merle. Ein Junge holt sein Smartphone aus der Tasche. „Darf ich auf Teams schauen?“ – „Ja.“ Merle schreibt die Matheaufgaben an das neue Smartboard. Sie selbst kann nicht auf Teams zugreifen und muss sich in solchen Situationen auf die Schüler verlassen.
Die Klasse beginnt zu arbeiten. Nach zwanzig Minuten wird es unruhig. „Ich versteh die vier nicht.“ Merle schaut ins Buch. „Ich auch nicht“, murmelt sie leise. Improvisieren und sich in verschiedene Themen einarbeiten, gehört zu ihrem Alltag. Koordinatensysteme, Fabeln, englische Grammatik – jeden Tag steht etwas Neues auf dem Plan. Eine halbe Stunde vor Schulschluss wird es wieder laut. Einige Kinder unterhalten sich, spielen mit ihren Mäppchen, laufen durch den Raum, stehen am Fenster. Nur wenige sind noch mit den Aufgaben beschäftigt. „Wenn alle fertig sind, können wir noch ein bisschen Film schauen. Aber dann müsst ihr euch jetzt alle hinsetzen.“ Merle ruft YouTube auf und sucht nach „Hanni und Nanni Teil 1“. Als der Film startet, wird es leise. „Das Schwierigste ist echt, die Klasse unter Kontrolle zu bekommen“, sagt die Aushilfslehrerin.
Um 12:50 Uhr packen die Kinder ihre Sachen. „Ich hab auch mal überlegt, Lehramt zu studieren, aber die Arbeit hier hat mir die Augen geöffnet – ne, will ich nicht“, resümiert Merle.
Merle will studieren – aber nicht Lehramt
Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für ein Lehramtsstudium, und viele, die es tun, brechen es ab. Zwischen 2011 und 2021 sank die Zahl der Lehramtsabsolventen von 33.500 auf 28.900 – ein Minus von fast 14 Prozent. Bildungsforscher Falk Radisch spricht von einer „Schwundquote“: Bundesweit brechen 30 bis 40 Prozent ihr Studium ab. Besonders betroffen sind die MINT-Fächer. In Mecklenburg-Vorpommern schlossen in den letzten vier Jahren gerade einmal drei Physiklehrkräfte ihr Studium ab – gebraucht wurden 80. Die Gründe sind bekannt: hohe Anforderungen, fehlende Beratung, eine unattraktive Berufsperspektive. Wie Schulen in Zukunft improvisieren müssen, ist noch unklar. Der stellvertretende Schulleiter einer hessischen Gesamtschule, Jan Peters, sieht keine Alternative zu den U+ Kräften. Allerdings meint er: „Es wäre wünschenswert, dass man gelernte Lehrkräfte als Reserve hat, die einspringen können. Insbesondere bei langfristigen Ausfällen.“
Freitagmorgen, Mitte März. Draußen hat es geschneit, drinnen beginnt der Unterricht in der G6. Eine Wand ist blau gestrichen, der Putz darunter blättert trotzdem ab. Ein kaputter Drehstuhl lehnt am Waschbecken, ein grüner Smiley ist an die Wand geschmiert. Auf einem Regal liegen lose Bücher, der Stundenplan hängt schief. Merle blättert im Buch und gibt den Schülern eine Aufgabe. Sie kennt ihre Namen – auf dem Lehrerpult liegt der Sitzplan. „Vincent, fang mal an. Tommy, du auch“, sagt sie und läuft durch die Reihen. Manche Kinder schreiben konzentriert, andere werfen sich Zettel zu. Als sie alle zur Ruhe bringen will, zählt sie laut runter: „Fünf … vier … drei …“ Die Klasse wird leiser, aber nicht lange. Ein klirrendes Geräusch – ein Lineal ist zerbrochen. „Hebt doch mal den Schmutz jetzt auf.“
Merle schreibt die Schüler, die durch den Klassenraum laufen, an die Tafel. Erst lachen ein paar, dann werden sie still. Bis zu den Sommerferien hat Merle noch Zeit, einzuspringen. Danach fängt sie an zu studieren – nicht Lehramt.