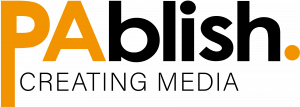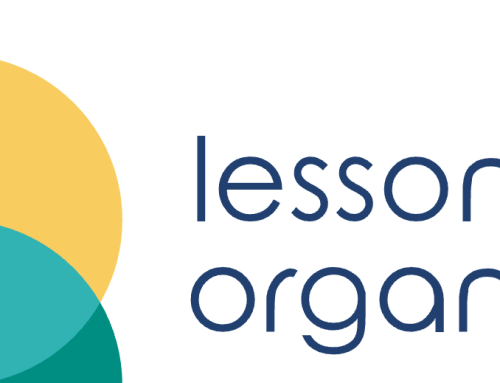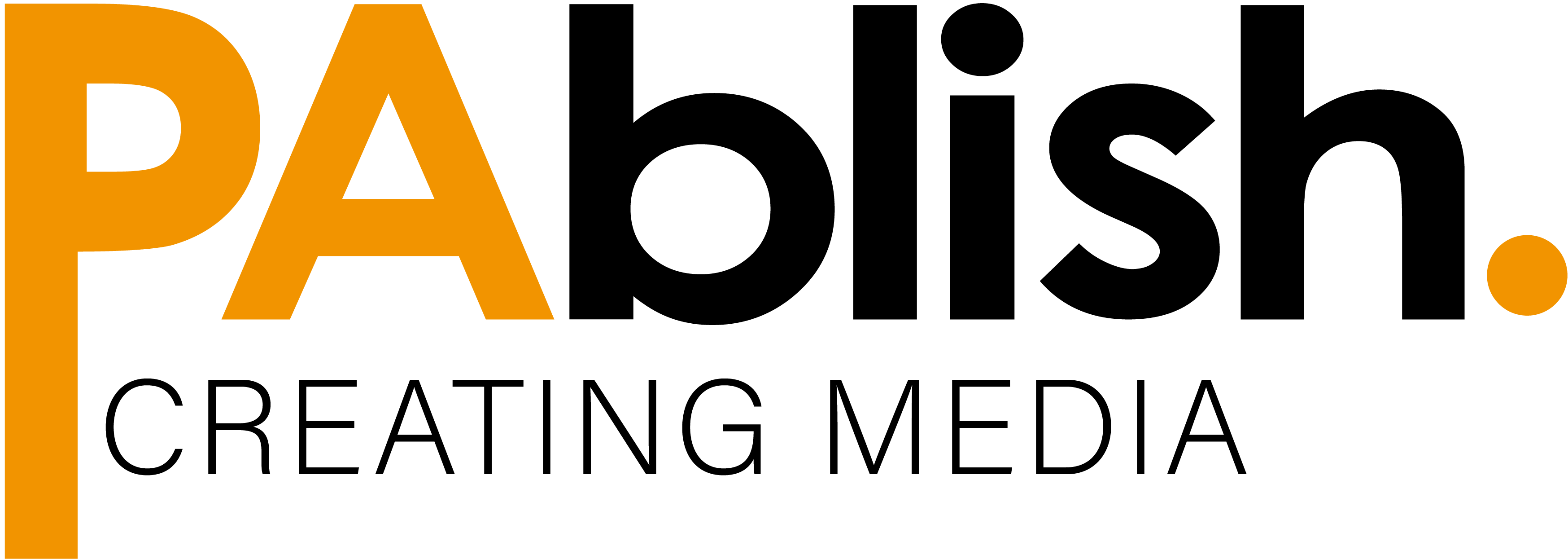Jedes Jahr am achten März, dem Internationalen Frauentag, strömen weltweit tausende von Menschen auf die Straßen, um für mehr Gleichberechtigung und die Rechte von Frauen zu kämpfen. Auch in Düsseldorf gehen sie auf die Straßen und Helin Şahin ist mittendrin. Gemeinsam mit der politischen Organisation „Feministische Kampftag Düsseldorf“ und der „kurdischen Frauenbewegung“ zieht sie durch die Stadt. Für Helin ist es die erste Demonstration in Deutschland und sie spürt sofort entscheidende Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten zu Protesten, die sie aus der Türkei kennt.
Von Lea Liebelt

Links und rechts ragen improvisierte Protestschilder in die Luft: alte Pizzaschachteln, bemalte Umzugskartons, umfunktionierte Boxen, auf der Rückseite noch die Aufschrift „Trödel“. Doch auf der Vorderseite sind klare Botschaften und gezielte Forderungen: „TAKE UP SPACE“; „STAND UP; SPEAK UP”; “GEGEN MACKER UND SEXISTEN”. Dazwischen blitzen grell pinke Trillerpfeifen überall in der Menge auf. Ob in Sneakern oder High Heels, im Rollstuhl oder mit einem Rollator, alle sind heute hier, um mitzulaufen, um für mehr Gleichberechtigung und die Rechte von Frauen zu kämpfen.
Ihre Oma kämpft für Gleichberechtigung in der Türkei
Die Wurzeln des Weltfrauentags reichen zurück in die USA. Dort wurde er erstmals im Jahr 1909 gefeiert und seit 1975 ist er offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt. Sein Ziel ist die Bekämpfung von Gewalt, Diskriminierung und Ausbeutung sowie die Förderung der Geschlechtergleichstellung.
In der zweiten Reihe steht Helin: schwarze hochhackige Stiefel, ihre dunklen Locken in einem Zopf und eine schwarze Lederjacke. In der einen Hand hält sie eine der pinken Trillerpfeifen, in der anderen Hand ein altes Pappschild, auf welchem in großen, schwarzen, wackligen Buchstaben „MAUSIS GEGEN MACKER“ steht. Heute ist nicht ihre erste Demonstration, jedoch ihre erste Demonstration in Deutschland.
Helin hat kurdisch-türkische Wurzeln und hat viele Sommer mit ihren Großeltern in der Türkei verbracht. Seit ihrer Kindheit blickt sie zu ihrer Großmutter auf, die ihr von Demonstrationen erzählte, auf welchen sie und ihr Mann für Demokratie und Gleichberechtigung in der Türkei kämpfen. Seit Helin 14 Jahre alt ist, darf sie ihre Großeltern manchmal begleiten. „Meine Familie ist sehr unterstützend. Sie wollen ebenso eine bessere Zukunft für ihre Töchter.“
 „Es fühlt sich an, als würden meine beiden Welten zusammenkommen – meine Wurzeln und mein Zuhause. Zu oft werden die beiden Seiten gegeneinander aufgehetzt. Heute laufen sie zusammen.“ Für Helin bedeutet dieser Tag mehr als nur eine Demonstration. „Gerade für die kurdische Frauenbewegung ist dieser Schulterschluss eine große Hilfe. Wären sie allein, wäre die Wahrnehmung der Gesellschaft anders. Menschen sehen die Flaggen und denken sofort an Extremismus, nur weil sie die Schriftzeichen nicht verstehen“, bemerkt Helin mit einem traurigen Lächeln.
„Es fühlt sich an, als würden meine beiden Welten zusammenkommen – meine Wurzeln und mein Zuhause. Zu oft werden die beiden Seiten gegeneinander aufgehetzt. Heute laufen sie zusammen.“ Für Helin bedeutet dieser Tag mehr als nur eine Demonstration. „Gerade für die kurdische Frauenbewegung ist dieser Schulterschluss eine große Hilfe. Wären sie allein, wäre die Wahrnehmung der Gesellschaft anders. Menschen sehen die Flaggen und denken sofort an Extremismus, nur weil sie die Schriftzeichen nicht verstehen“, bemerkt Helin mit einem traurigen Lächeln.
Die Friedrich-Ebert-Straße füllt sich. Die Menge versammelt sich eng um die Rückseite des LKWs, der als provisorische Bühne gilt. Seine Seiten mit Bannern behangen und drei große Boxen an beiden Seiten sollen das gesprochene Wort bis in die letzten Reihen tragen. Eine Gebärdendolmetscherin steht auf der linken
Seite der Bühne und übersetzt. Ihre Hände fliegen dabei schnell in der Luft. Die Stimmung ist ausgelassen und immer wieder hört man den schrillen Ton der Trillerpfeifen durch die Luft zischen. Die Demonstranten scharren förmlich mit den Hufen loszulegen.
Tränen kullern über ihre Wangen
Dann knistern die Lautsprecher und die erste Rednerin tritt ans Mikrofon, eine Vertreterin der kurdischen Frauenbewegung. „Wir wollen leben mit all unseren Kulturen, Religionen und Sprachen“, sagt sie mit fester Stimme. „Jin Jiyan Azadi“ ruft die Rednerin und Helin übersetzt unmittelbar: „Frau, Leben, Freiheit.“
Der nächste Beitrag folgt, zwei Vertreterinnen des „Gute-Nacht-Busses“ treten auf die Plattform des LKW. Sie erzählen von obdachlosen Frauen und wie sie in unserer Gesellschaft oft übersehen werden: „Sie gehen in den Statistiken unter.“
 Helin steht mit verschränkten Armen, ihre ganze Aufmerksamkeit der Rede gewidmet. Sie blinzelt heftig, doch ein paar Tränen kullern ihre Wangen herunter. Weitere Redebeiträge folgen und immer wieder tauchen dieselben Worte auf: Stolz, Mut, Kraft, Erfolg. Sie hallen durch die Straßen, brennen sich in die Köpfe der Zuhörenden. Eine ständige Erinnerung. Eine Motivation. Eine Mahnung.
Helin steht mit verschränkten Armen, ihre ganze Aufmerksamkeit der Rede gewidmet. Sie blinzelt heftig, doch ein paar Tränen kullern ihre Wangen herunter. Weitere Redebeiträge folgen und immer wieder tauchen dieselben Worte auf: Stolz, Mut, Kraft, Erfolg. Sie hallen durch die Straßen, brennen sich in die Köpfe der Zuhörenden. Eine ständige Erinnerung. Eine Motivation. Eine Mahnung.
Während der Beiträge bleibt es meist still. Die Menschen lauschen, nicken, lachen oder wischen sich verstohlen Tränen aus den Augen. Doch immer wieder wird die Stille von donnerndem Applaus durchbrochen. Helin steigt immer mit einem stolzen Lächeln sofort mit ein.
Die Bundeszentrale für politische Bildung benennt die aktuellen Herausforderungen klar: die Diskriminierung von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt; der bestehende Gender Pay Gap; fehlende Gesetze gegen die Diskriminierung von Frauen und fehlende Gleichberechtigung bei Ehe und Scheidung; sowie den eingeschränkten Zugang von Millionen von Frauen zu Bildung und Gesundheit.
Sicher Demonstrieren – ein Privileg
Gemäß Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes steht allen Deutschen das Recht zu, sich friedlich zu versammeln und so politisch zu engagieren. In vielen Ländern sieht die Realität anders aus. „Hier fühle ich mich sicher. Das ist ein großer Unterschied“, berichtet Helin. In der Türkei sind Demonstrationen oft riskant. Genehmigungen sind schwer zu bekommen. Proteste werden verboten und müssen oft abgesagt oder abgebrochen werden, da es Provokation von außen gibt. Gegner schmeißen Gegenstände auf Demonstranten oder das Militär löst sie zwangsweise auf.
Eine junge Polizistin begleitet die Demonstration am Rande des Zuges. Sie blickt ruhig auf die Menge. „Ich habe noch nie eine gewaltsame Demonstration miterlebt, und dies ist nicht meine erste“, antwortet sie gelassen auf Nachfrage. Doch es ist nicht nur die Sicherheit, die für Helin erkennbar unterschiedlich ist. „Die Stimmung ist eine andere“, bemerkt sie und lässt ihren Blick nachdenklich über die Demonstration schweifen, „Leute lachen und umarmen sich. In der Türkei wird oft geweint und geschrien, das ist ihre Art Verbundenheit und Mitgefühl zu zeigen.“ Die Atmosphäre in Düsseldorf ist gelöster und leichter, aber die Entschlossenheit ist dieselbe. Ob in Düsseldorf oder Istanbul der Wille ist beständig.
Durchdachte Choreografie
Langsam setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Helins Absätze klackern auf dem Asphalt, Rollstühle surren, Musik dröhnt aus den Lautsprechern des anführenden LKW. Weiter hinten treiben Trommeln den Rhythmus an. Reihe in Reihe, Schulter an Schulter, doch es herrscht kein Gedränge, kein beengendes Gefühl. Es ist genug Platz. Rund 2.200 Menschen laufen mit, soviel dass die Friedrich-Ebert-Straße in ein Meer aus lauten Schildern, bunten Flaggen und rhythmischer Musik verwandelt wird. Der Schritt bleibt bewusst langsam, bedacht, dass jeder mitkommt und niemand zurückbleibt. Der Zug ist klar strukturiert: vier Blöcke, vier Botschaften. An der Spitze der FLINTA-Block (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen), der die Fokussierung des Tages widerspiegelt. Dahinter der Leere-Block, abgesperrt mit schwarzem Band, an welchem weiße Zettel kleben, die in dicken schwarzen Buchstaben mahnende Botschaften und Erinnerungen tragen. Der Block ist symbolisch für die Opfer von Femiziden. Danach folgt der gemischte Block,
in dem Menschen aller Geschlechter solidarisch Seite an Seite gehen. Den Abschluss bildet der ruhige Block, ein Raum für Menschen, die lieber ruhig, aber ebenso entschlossen demonstrieren wollen.
 Ein Ruf geht durch die Menge: „Ehe, Küche, Vaterland. Unsere Antwort: Widerstand!“ und breitet sich aus. Die ersten Reihen stimmen lautstark ein, die Worte rollen wie eine Welle durch die Straße. Beim zweiten Mal hebt auch Helin zaghaft ihre Stimme, noch ungewohnt und unsicher. Aber bei jeder Wiederholung ruft
Ein Ruf geht durch die Menge: „Ehe, Küche, Vaterland. Unsere Antwort: Widerstand!“ und breitet sich aus. Die ersten Reihen stimmen lautstark ein, die Worte rollen wie eine Welle durch die Straße. Beim zweiten Mal hebt auch Helin zaghaft ihre Stimme, noch ungewohnt und unsicher. Aber bei jeder Wiederholung ruft
sie etwas lauter. Um sie herum tanzen Menschen ausgelassen, schwingen Fahnen, singen zur Musik und klatschen im Takt. Euphorie liegt in der Luft. Helin atmet tief ein, ein Lächeln liegt ihr auf den Lippen.„Ich fühle mich gut“, sagt sie mit erhobenem Kopf. „Ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin.“
Am Ende der Demonstration beantwortet Helin die Frage, warum sie heute hier ist. Ihre Antwort kommt nach kurzem Zögern: „Ich bin hier, weil ich es satthabe, dass Frauen ständig für alles verantwortlich gemacht werden – für die Gewalt, die sie erfahren und für die Ungleichheit, unter der sie leiden. Ich will nicht in
einer Welt leben, in der Frauen immer noch als schwächer oder als Objekt dargestellt werden. Ich möchte, dass wir endlich als gleichwertige Menschen gesehen werden. Wir müssen in Schulen, Medien und in unserem Alltag klarmachen: Sexismus ist kein ‚kleines Problem‘, sondern eine strukturelle Ungerechtigkeit, die bekämpft werden muss.“