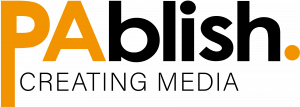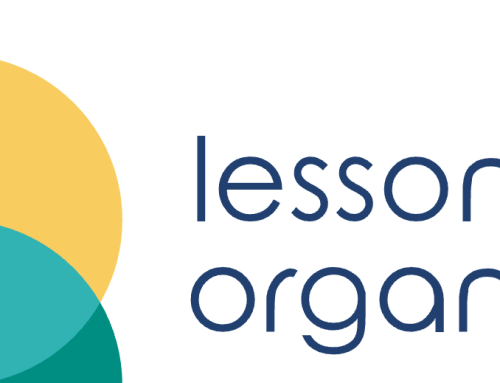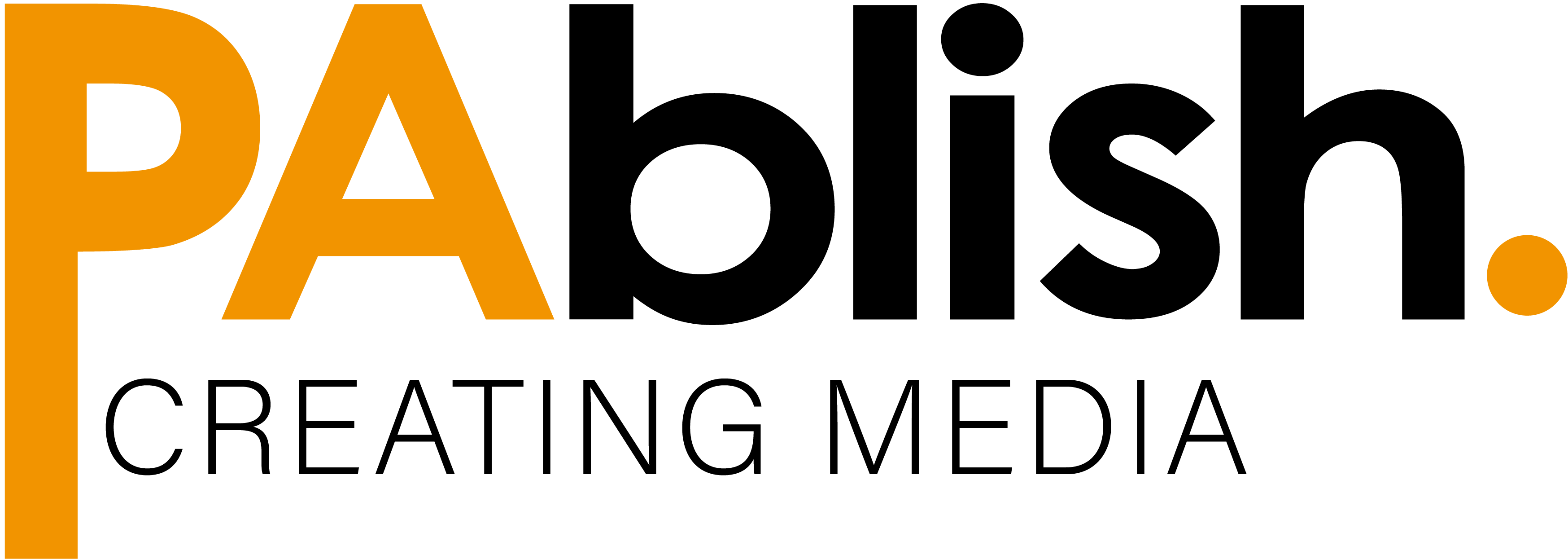Freiheit beginnt im Kopf
Welche Menschen schließen sich Sekten an und was bringt sie dazu, wieder zu gehen? Drei Aussteiger:innen erzählen von ihren Erfahrungen in der Gruppe und davon, wie es ist, sich ein freies Leben erkämpfen zu müssen. Ein Beitrag über Kontrolle, Schuld und Mut.
von Mia Rebhan und Selini Schröer

Jesus-Kreuz
Wer sich nach Orientierung und Zugehörigkeit sehnt, ist oft besonders verletzlich. Manche Gruppierungen nutzen genau diesen Wunsch aus und ersetzen Gemeinschaft durch Kontrolle. Zwei Menschen erzählen, wie sie den Mut gefunden haben, aus einer destruktiven Gruppe auszusteigen und was ihnen geholfen hat, im Alltag wieder Fuß zu fassen.
Anna
„Zehn Jahre lang habe ich geglaubt, alles richtig zu machen“, sagt Anna. Zehn Jahre war sie Teil einer destruktiven Gruppe – einer Gemeinschaft, in der Kontrolle, Abhängigkeit und psychischer Druck den Alltag bestimmen. Aus Angst, jemand aus ihrer früheren Gemeinschaft könnte sie wieder erkennen, möchte sie anonym bleiben.Ihr Name wurde geändert.
Anna ist Anfang dreißig. Sie hat ein hübsches, leicht rundliches Gesicht, übersät mit Sommersprossen. Darunter verbirgt sich auffällig blasse Haut. Im Laufe des Gesprächs färbt sie sich – manchmal aus Scham, manchmal vor Wut – rötlich.
Zehn Jahre richtet Anna ihren Alltag nach den Vorstellungen eines einzigen Mannes aus. Er bestimmt welche Frisur sie trägt, wann sie isst und mit wem sie schläft.
Der Mann, von dem Anna spricht, ist selbsternannter Coach.
Was zeichnet einen Coaching-Guru aus?
➢ Führerkult
➢ Wahrheitsmonopol
➢ Mystifizierung
➢ Kritikunfähigkeit
Dieser Coach ködert seine Opfer mit Versprechen und Hoffnungen: Heilung, Zugehörigkeit, Sinnhaftigkeit. Er bietet scheinbar einfache Lösungen für tiefgreifende Probleme. Er setzt genau dort an, wo Menschen am verletzlichsten sind. Im Fokus seines Interesses: Frauen in Lebenskrisen. Und noch mehr: deren Töchter. Eine dieser Töchter ist Anna. Mit Anfang zwanzig, orientierungslos nach dem Studium und verzweifelt auf der Suche nach Halt, wird sie von ihrer eigenen Mutter an den Mann vermittelt, der fortan über ihr Leben bestimmen wird. Was zunächst wie ein harmloses Beratungsangebot erscheint, wird schleichend zu einer Vereinnahmung ihres gesamten Lebens.
„Ich hatte zehn Jahre lang mit einem Großteil von eigentlich allen Familienmitgliedern und Freund:innen keinen Kontakt, die nicht Teil dieser Gruppe waren“
Anna
Die Gruppe, der Anna sich damals anschließt, lebt gemeinsam unter einem Dach. Sie reisen, essen und schlafen zusammen. Sie sind wie eine Familie. Doch hinter dieser vermeintlichen Geborgenheit versteckt sich systematischer Missbrauch: emotional, psychisch, teils auch körperlich. Anna erzählt von ihrem Alltag: Jeden Tag findet ein anderes Gruppenseminar statt. Manchmal stehen die Frauen abwechselnd in der Mitte eines Kreises, während die anderen sie kritisieren müssen. Es fallen Begriffe wie „faul, dick, hässlich”. Es fördere das „innere Wachstum“, sei gut für die „emotionale Reife“. Annas Gesicht wird dunkelrot, als sie darüber spricht. Die Worte haften noch immer an ihr.
In manchen Sitzungen geht es noch tiefer: Mütter und Töchter sitzen sich gegenüber, sprechen über ihre Väter, ehemaligen Partner:innen, die offenen Wunden und Traumata. Jede muss intime Erlebnisse und Traumata mit der Gruppe teilen – ob sie will oder nicht. Die Grenze zwischen Offenheit und Übergriff verschwimmt. Zwischen den Gruppensitzungen finden auch Einzelgespräche mit dem Coach statt. Jede Frau verbringt Zeit mit ihm allein. In Wahrheit, sagt Anna, wollten viele vor allem eines: bei ihm beliebt sein. Auch das gehört zur Dynamik der Gruppe.
Als sie von körperlichem Missbrauch spricht, wird ihre Stimme zittrig, ihre Augen glasig. Es ist einer dieser Momente, in denen man spürt, dass jede weitere Frage zu viel wäre.
Wer Zweifel äußert oder darüber nachdenkt, zu gehen, wird gewarnt: Die Gruppe könne persönliche Geheimnisse öffentlich machen. Der Kontakt zur Außenwelt ist nahezu untersagt.
„Man vertraut, weil man Antworten sucht. Wenn sogar die eigene Mutter diesen Menschen empfiehlt, dann glaubt man ihm noch mehr. Er kriegt sozusagen einen Vertrauensvorschuss – wie ein Arzt. Und man merkt oft zu spät, dass Missbrauch passiert“
Anna

Anna
Die Frauen in der Gruppe haben keine Freund:innen, keine Arbeit, kein eigenes Geld. Sie sind finanziell und emotional abhängig. Ein Ausstieg? Für die meisten undenkbar – zu gefährlich. Anna geht es genauso. Wenn sie darüber nachdenkt, die Gruppe zu verlassen, stellen sich ihr Ängste in den Weg. Doch im Laufe der Zeit ändert sich die Dynamik in der Gruppe: Der Coach kann seine Versprechen in Bezug auf Glück und Reichtum nicht halten. Schrittweise beginnt Anna, sich zu lösen. Sie geht öfter nach draußen, sucht Kontakt zu der Welt, die ihr so lange als gefährlich dargestellt worden war. Zu Beginn geht sie allein spazieren, dann ab und zu in ein Café, das zu Fuß zu erreichen ist; und irgendwann spricht sie mit den Menschen in der Stadt. Das erste Mal seit Jahren redet sie überhaupt mit Menschen außerhalb ihrer Gemeinschaft. Die Angst vor dem Alleinsein und dem Scheitern in der neuen Welt ist noch groß, doch irgendwann erreicht sie den Punkt of no return.
„Man ist einfach allein. Also man ist so allein, wie man die Definition von Alleinsein schreiben würde – im schlimmsten Fall.“
Diese Worte wählt Anna, um ihre Zeit kurz nach dem Ausstieg zu beschreiben. Sie verlässt die Staaten und kommt zurück in ihre Heimat. Langsam erobert sie sich ihr eigenes Leben zurück. Doch das Gefühl, mit dem Erlebten allein zu sein, bleibt.
„Ich wollte meine Erfahrungen irgendwie in eine Form von Normalität bringen, in eine Form von: „Aha: „Anderen Menschen geht es auch so und ich bin doch nicht so allein damit“.”
Aus diesem Wunsch heraus gründet sie eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Für all jene, die den Mut hatten, zu gehen, und nun einen Ort suchen, an dem sie wieder ankommen können. Es hat gedauert, bis Anna erkennt, was sie erlebt hat. Erst Monate nach dem Ausstieg – in einem neuen sozialen Umfeld – spricht sie offen über ihre Vergangenheit. Sie erzählt, dass ihr Coach klare Regeln aufgestellt hatte: Was sie anziehen durften, wann und wie lange sie schlafen sollten, welche Bücher oder Quellen erlaubt waren – und welche nicht. Und dann war da dieses Gefühl von Schuld, wenn man eine Regel nicht richtig beachtete. Und gleichzeitig das Verlangen nach Anerkennung, nach der Liebe des Coaches, die so selten und doch so wichtig schien.
„Du weißt schon, dass sich das alles ziemlich nach einer Sekte anhört?“, sagt jemand zu ihr.
Das Wort Sekte erwischt Anna kalt. Nie zuvor hatte sie darüber nachgedacht, in welcher Struktur sie festgehalten wurde. Erst heute kennt sie Begriffe wie das BITE-Modell des US-amerikanischen Psychologen Steven Hassan, der vier Formen der autoritären Kontrolle beschreibt: Verhalten (behavior), Information (information), Gedanken (thought), Emotionen (emotions). Alles darin Beschriebene spiegelt ihre eigenen Erfahrungen wider.
Trotzdem meidet Anna das Wort Sekte. Es sei stigmatisierend, sagt sie. Sie spricht lieber von einer destruktiven Gruppe – einem Begriff, der besser beschreibt, was sie erlebt hat.
Destruktive Gruppen
Der Begriff Sekte ist schwierig. Nicht nur die Wissenschaft distanziert sich davon, sondern auch Betroffene selbst. Warum eigentlich? Sekte klingt negativ – aber schließlich geht es um Machtmissbrauch, Abhängigkeit und psychischen Druck. Und trotzdem sprechen die meisten Aussteiger:innen von destruktiven Gruppen. Sie lassen sich den Stempel Sekte nicht mehr aufdrücken.
Auch in der Beratungsstelle für Betroffene und Aussteiger:innen Sekteninfo NRW verwendet man bewusst den Begriff destruktive Gruppe – nicht, um zu verharmlosen, sondern um genauer zu beschreiben, worum es tatsächlich geht. Entscheidend sind dabei nicht die Inhalte der Ideologie, sondern die Strukturen, in denen Menschen gefangen sind. Typische Merkmale destruktiver Gruppen sind laut der Beratungsstelle eine autoritäre Führung, starke emotionale oder finanzielle Abhängigkeiten, Abschottung nach außen und die systematische Kontrolle von Denken, Fühlen und Verhalten. Der Begriff destruktive Gruppe schafft also etwas, das Sekte nicht leisten kann: Er benennt das Unrecht, ohne die Betroffenen zu stigmatisieren. Denn während Sekte schnell mit Fanatismus oder persönlicher Schuld assoziiert wird, benennt destruktive Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes das zerstörerische Potenzial solcher Strukturen.
Gernot
Auch der Aussteiger Gernot Buth kennt dieses Ringen um Sprache. Er ist Anfang sechzig und trägt eine große Nickelbrille auf der Nase. Trotzdem fallen seine stechend blauen Augen auf. Sie durchdringen einen förmlich. Lange war Gernot Teil der missionarischen Hochschulgruppe Die Navigatoren. Zu dieser Zeit hat er den Begriff Sekte weit von sich gewiesen.
Die Navigatoren
„Jemand hat damals das Wort Sekte an die Tür unseres Bibelkreises geschmiert. Ich war empört und dachte: „Was soll das?“ Aber heute würde ich das sofort unterschreiben.“
Gernot

Gernot
Das Danach
In den 80erJahren studierte Gernot Physik an der Universität Bonn. In seiner ersten Vorlesung geht es um die Entwicklung des Universums, der Erde und des Lebens. Ein Professor bezieht sich auf das Buch „Am Anfang war der Wasserstoff“ von Hoimar von Ditfurth. Erst Jahre später wird Gernot es aufschlagen und darin Antworten finden, die seine Welt ins Wanken bringen.
In der Mensa lernt er Markus kennen. Markus ist bereits Mitglied der Hochschulgruppe Die Navigatoren. Die beiden freunden sich an und von da an liest Gernot Bibelverse, diskutiert über Wahrheit und Erlösung und geht regelmäßig zu den Bibelkreisen der Gruppe. Was sich zu Beginn wie echte Freundschaft anfühlt, entpuppt sich im Nachhinein als Täuschung. Denn unter der Oberfläche unterliegt die Gruppe klaren Mustern: strukturelle Hierarchien, geistiger Gehorsam und ein stetiger Druck zur Anpassung. Wer ein Treffen versäumt, bekommt am nächsten Tag Besuch. Seine Lehrmeister im Glauben drohen mit dem Teufel und der ewigen Hölle. Ängste, die Gernot bis heute schlaflose Nächte bescheren.
Je mehr diese Ängste seinen Alltag bestimmten, desto größer werden seine Zweifel. Immer mehr beginnt er, seinen Glauben zu hinterfragenund schlägt schließlich das Buch auf, das nun schon lange unberührt in seinem Regal steht: „Am Anfang war der Wasserstoff“. Der Gedanke, dass Wissenschaft die Welt erklärt, widerspricht allem, was Die Navigatoren predigen.
Gernot entscheidet sich für die Wissenschaft und lässt den Glauben hinter sich. Wenn er heute an seine Zeit in der missionarischen Gemeinschaft Die Navigatoren zurückdenkt, vergleicht er sie mit einem Placebo-Effekt: ein Medikament, das wirkt, solange man nicht weiß, dass es keinen Wirkstoff enthält – und dessen Wirkung erlischt, wenn man es einmal durchschaut hat.
„Der Glaube hat funktioniert, weil ich daran geglaubt habe – wie ein Placebo. Als ich das begriffen hatte, gab es kein Zurück mehr“, erzählt er. Heute spricht er von kognitiver Dissonanz. Den Begriff kannte er damals noch nicht. Er beschreibt den inneren Konflikt, der entsteht, wenn jemand widersprüchliche Gedanken, Überzeugungen oder Handlungen erlebt und versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. In Gernots Fall: Wissenschaft versus Glauben.
Was beide Biografien verbindet, ist nicht nur die Zeit innerhalb der destruktiven Gruppe, sondern auch das Danach – das Gefühl, nicht mehr zurückzukönnen und gleichzeitig plötzlich im Nichts zu stehen.
„In dem Moment, wo man austritt, ist es ja irgendwie unklar, wer man selber ist. Es gibt keinen Freundeskreis mehr, keinen Job, oft nicht mal ein Dach über dem Kopf“
Anna
Auch Gernot erlebt nach dem Ausstieg eine existenzielle Leere und eine ungeklärte Beziehung zum Glauben: „Ich danke dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen“, sagt er und zitiert damit den Physiker Lichtenberg. „Ich wollte alles – nur nie, nie, nie ein Atheist sein. Der Kompromiss ist ein schwieriger”
Seine Sehnsucht nach Halt in der Religion wurde ausgenutzt und genau deshalb kann er heute nicht mehr glauben, auch wenn er sich das manchmal noch wünscht.
Was ihm hilft, ist der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben. „Da habe ich verstanden, dass ich nicht allein bin und dass die Inhalte der Kulte austauschbar sind. Die Strukturen ähneln sich fast immer“, erzählt er.
Die Strukturen in destruktiven Gruppen: Was haben alle diese Gruppen gemeinsam?
➢ Das Weltbild der Gruppe ist verblüffend einfach und erklärt jedes Problem
➢ Ich soll sofort Mitglied werden
➢ Die Gruppe will, dass ich alle alten Beziehungen abbreche, weil sie meine Entwicklung behindern
➢ Die Menschheit treibt auf eine Katastrophe zu und nur die Gruppe weiß, wie man die Welt retten kann
➢ Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe Recht hat
Gernot ist schon viele Jahre Teil einer Selbsthilfegruppe für ehemalige Mitglieder fundamentalistischer Glaubensgemeinschaften. Anna hat Anfang dieses Jahres ihre eigene Gruppe gegründet. Darin geht es um Themen wie Selbstfürsorge, Abgrenzung und Vertrauen.
„Wir therapieren niemanden. Wir teilen unsere Erfahrungen und machen das, was uns passiert ist, ein Stück weit verständlich“, sagtAnna.
Viele Menschen, die eine destruktive Gruppe verlassen haben, stehen vor der gleichen Frage: Wo gehöre ich jetzt hin? Denn der Ausstieg ist nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang einer neuen.
Wie gerät man in die Fänge einer destruktiven Gruppe? Laut Julia Liebrand von der Beratungsstelle Sekteninfo NRW sind es weniger bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, sondern vielmehr Lebensumstände, die Menschen anfällig für derartige Gruppen machen. Wer in einer Krise steckt, nach Orientierung sucht oder sich einsam fühlt, ist besonders verwundbar.
„Manchmal reicht schon der Verlust eines nahestehenden Menschen oder ein Gefühl der Leere, um offen für scheinbar einfache Antworten zu sein“, erklärt sie.
In Gernots Fall war es der Tod seines geliebten Großvaters, der ihn anfällig für die Suche nach einfachen Antworten gemacht hat. Bei Anna war es das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Orientierung.Erst rückblickend wird den beiden bewusst, wie sehr sie kontrolliert wurden. Die Anführer:innen der Gruppe entscheiden, was gegessen wird, welche Bücher sie lesen und welchen Medien sie vertrauen. Das eigene Denken wird zunehmend fremdgesteuert.
Doch mit dem Ausstieg beginnt für viele Betroffene erst die eigentliche Belastung.
Doris Zauner, Referentin für Weltanschauungsfragen im Bistum Passau, kümmert sich um Menschen wie Anna und Gernot und hilft ihnen, nach dem Ausstieg aus einer destruktiven Gruppe wieder Fuß zu fassen. „Die meisten kommen zu uns in einem Moment großer Erschöpfung. Sie haben Angst, Scham und Schuldgefühle.”
Anna erinnert sich zurück: „Ich war mit Schuld in beide Richtungen konfrontiert. Die Schuld, nicht mehr Teil der alten Gruppe zu sein, aber auch nicht richtig in die neue Welt hineinzupassen. Das ist erstmal ein ganz herber Schlag.”
Gernot ist schon lange kein Teil mehr der Navigatoren, aber in manchen Nächten holt ihn seine Vergangenheit ein. Dann wacht er schweißgebadet auf. In der Dunkelheit sieht er, was er lange geglaubt hat: den Teufel und die Hölle direkt über ihm– als würde die Decke nachgeben.
Anna möchte bis heute nicht, dass ihr echter Name genannt wird. Wovor genau sie Angst hat, lässt sich nur vermuten. Aber dass die Angst real ist, spürt man in jedem ihrer Worte.
Ist das denn rechtens?
Die rechtliche Einordnung solcher Gruppen ist kompliziert. Denn der Begriff Sekte ist juristisch nicht definiert. „Es gibt keine rechtlichen Kriterien, die eine problematische Gruppe von einer akzeptierten Religionsgemeinschaft abgrenzen“, erklärt die Juristin Anna Massenberg von der Beratungsstelle Sekteninfo NRW. Das Grundgesetz schützt die Religionsfreiheit; aber dieser Schutz ist nicht grenzenlos. Wenn durch die Aktivitäten einer Gruppe die Rechte Dritter verletzt werden, etwa durch psychische Ausbeutung oder wirtschaftlichen Betrug, darf und muss der Staat eingreifen. In der Praxis bleibt das jedoch schwierig. Meist fehlt es an Beweisen, an Zeugenaussagen oder an Mut, Anzeige zu erstatten.
„Viele Menschen, die bei uns Hilfe suchen, haben Angst vor Konsequenzen oder fühlen sich zu geschwächt, um rechtlich aktiv zu werden“, erklärt die Psychologin Frau Liebrand von der Beratungsstelle. Hinzu kommen finanzielle Sorgen, Unsicherheiten im Umgang mit Behörden oder das Gefühl, ohnehin nicht ernst genommen zu werden.
Was brauchen Menschen nach dem Ausstieg aus einer destruktiven Gruppe? Für Anna und Gernot ist klar: den Kontakt zu Menschen, die Ähnliches erlebt haben.
Annas eigene Selbsthilfegruppe ist ein Ort des Zusammentreffens. Es geht um alltägliche Fragen wie: „Wie sage ich Nein? Wie gehe ich mit Scham um? Wie mache ich mich frei?“
Beide berichten von gesellschaftlichen Vorurteilen. Anna sagt:
„Ich glaube, viele denken, man ist einfach nur leichtgläubig gewesen oder dumm. Fast jeder ist in bestimmten Momenten seines Lebens empfänglich für so etwas. Manchmal ist es einfach nur Glück, wem man in solchen Phasen begegnet – oder besser gesagt – nicht begegnet“
Anna

Selini & Mia
Wir haben gelernt, wie schnell man in eine destruktive Gruppe geraten kann und wie viel Mut ein Ausstieg erfordert. Die Begegnungen haben uns nicht nur journalistisch, sondern auch menschlich geprägt.