Dich will ich, dich will ich nicht
Neun von zehn Kindern mit Down-Syndrom werden nie geboren. Nicht nur Trisomie 21, auch andere Chromosomenstörungen oder Fehlbildungen kann man bereits vor der Geburt mittels pränataler Diagnostik feststellen. Werdende Eltern entschließen sich oftmals zum Schwangerschaftsabbruch, wenn der Befund auf eine Behinderung des Kindes hindeutet. Die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Untersuchungen werfen die Frage auf, wem die Macht über die Entscheidung von Leben und Tod obliegt. Wer sagt, welches Leben lebenswert ist?

Von Lena Stockinger
Barbara Schmitz lächelt, als sie von ihrer Tochter zu erzählen beginnt. Mit einer Tasse Kaffee sitzt sie in ihrem holzverkleideten Wohnzimmer in Engadin in der Schweiz, einem der höchstgelegenen bewohnten Tälern Europas. Sie wirkt geerdet, strahlt Ruhe und Bedachtheit aus. Hier wohnt sie mit ihrer Tochter, der inzwischen 23-jährigen Carlotta. Hätte Schmitz auf den Rat und die Prognosen der Ärzt*innen gehört, würde diese jedoch heute gar nicht leben.
Carlotta kam 1999 überraschend mit dem seltenen Robinow-Syndrom zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt waren weltweit nur 100 bestätigte Fälle bekannt. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung liegt bei 1 zu 500 000. Pech würden die einen sagen, „Glück“, nennt es Schmitz: „Es ist ein reiches Leben, wenn ein Kind einen ganz neuen Blick auf die Welt mitbringt.“ Für die Philosophin war die Geburt ihrer Tochter der anlassgebende Grund, sich erstmals mit der Frage nach einem lebenswerten Leben auseinanderzusetzen.
Eine Frage, die sich 1999 mangels vorgeburtlicher Untersuchungsmethoden noch nicht stellte. Die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik begrenzten sich unter anderem auf die Durchführung einer Fruchtwasserpunktion, die allerdings mit einem erhöhten Risiko einer Fehlgeburt einhergeht. Schmitz lehnte diese bewusst ab. „Ich war in keiner Risikogruppe, es gab keinerlei familiäre Auffälligkeiten. Ich habe nie daran gedacht, dass mein Kind eine Behinderung haben könnte.“ Bis heute sei sie froh, dass sie sich so entschieden hatte. Nur so konnte sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen, war sorglos und freute sich ohne Bedenken auf ihre Tochter. „Es war verdammt gut so. Was hätte es mir genützt, wenn ich alles bereits pränatal gewusst hätte?“
Carlotta wurde mit zwölf Fingern und einem überdurchschnittlich großen Kopfumfang geboren. Als die Ärzt*innen nach drei Monaten die seltene Genveränderung diagnostizierten, bestand an der bedingungslosen Liebe zwischen Mutter und Tochter dennoch kein Zweifel. Mit der Diagnose gingen aber auch schlechte Prognosen der Mediziner*innen einher. Betroffene des Robinow-Syndroms leiden häufig an Kleinwuchs, verkürzten Gliedmaßen oder schwerwiegenden Wirbelsäulendeformierungen sowie Atemwegserkrankungen. „Man hat uns eine Liste in die Hand gegeben, welche Symptome sie bekommen kann. Das war ganz furchtbar. Man hat uns Bilder von älteren Kindern mit demselben Syndrom gezeigt und ich war zutiefst erschrocken damals“, erinnert sich Schmitz.
Die Sache mit den Zahlen
Seit der Diagnose hat sich viel verändert – sowohl im Leben von Carlotta als auch in der pränatalen Diagnostik. Die 23-Jährige ist entgegen den ärztlichen Erwartungen heute weder kleinwüchsig noch zeigt sie Ausprägungen anderer körperlicher Symptome. Mit ihrer geistigen Beeinträchtigung kommt die Familie gut zurecht. „Carlotta ist nicht unverstehbar oder fremd, sie ist im Grunde ganz genauso ein Mensch wie ich. Sie hat ganz viele Gefühle, die ich auch habe. Manche davon zeigen sich anders oder sind bei Carlotta stärker ausgeprägt als bei mir. Alle meine Bilder, die ich von geistiger Behinderung hatte, wurden durch sie entkräftet“, hält Schmitz fest. Zuvor hatte auch sie Berührungsängste in Bezug auf „ ‚das Fremde‘, das ‚Andere‘ oder ‚Unverständliche‘“, das in der Gesellschaft häufig mit geistiger Beeinträchtigung assoziiert wird.
Inzwischen kann das Robinow-Syndrom ab der 19. Schwangerschaftswoche durch einen Fehlbildungsultraschall relativ sicher nachgewiesen werden, jedoch ohne die Schwere der Diagnose vorauszusagen. Bei den Prognosen der Ärzt*innen handelt es sich demnach zumeist um Wahrscheinlichkeiten. Besonders diese sind für Eltern oft schwer einzuschätzen, wie die Philosophin und Universitätsdozentin unterstreicht: „Es ist extrem schwierig für Menschen mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Wissen, das nicht vollkommen gesichert ist, wird ganz oft nicht rational eingeordnet.“ Dr. Veronika Beck, leitende Oberärztin für Pränataldiagnostik am Klinikum Passau, erlebt genau das bei ihren Patientinnen in der Praxis: „Die Ausprägungen bestimmter Krankheitsbilder können extrem unterschiedlich sein. Dies trifft insbesondere auch auf die Trisomie 21 zu, die von einer milden Beeinträchtigung bis hin zu einem nicht lebensfähigen Kind, das ganze Spektrum umfasst. Die individuelle Prognose für das Kind und die jeweilige Familie abzuschätzen kann daher schwierig sein und den Eltern die Entscheidung für oder gegen die Schwangerschaft sehr schwer machen.“
Auch andere Methoden der pränatalen Diagnostik sorgen aufgrund von falsch-positiven Ergebnissen immer wieder für Aufsehen. Neben dem Fehlbildungsultraschall und der Feindiagnostik, bei der die Lage und Entwicklung der wichtigsten Organe des Kindes untersucht werden, gibt es mit dem nicht-invasiven Pränataltest (NIPT) die Möglichkeit, über das mütterliche Blut das Erbgut des ungeborenen Kindes auf die Trisomien 13, 18 und 21 zu untersuchen. Seit Juli 2022 wird dieser in bestimmten Situationen von der Krankenkasse gedeckt und ist daher für die Schwangeren kostenlos.
Nicht-Invasiver Pränataltest (NIPT)
Nicht-Invasiver Pränataltest (NIPT)
Der NIPT-Test ist ein Bluttest, mit dem ab der 10. Schwangerschaftswoche Hinweise auf die Trisomien 13, 18 und 21 gegeben werden können. Da dies über eine Blutabnahme erfolgt und kein Eingriff in die Gebärmutter der Mutter notwendig ist, handelt es sich um ein nicht-invasives Verfahren. Weitere nicht-invasive Methoden der Pränataldiagnostik sind die Nackenfaltenmessung oder das Organscreening.
Dr. Beck beobachtet seither einen Anstieg an durchgeführten NIPT-Tests in den Frauenarztpraxen. Auffällig sei, dass sich auch zunehmend mehr Frauen, die kein erhöhtes Risiko für Trisomie 21 haben, für den Bluttest entscheiden. Eine 100%ige Sicherheit verspricht er allerdings nicht, weshalb Schwangerschaftsabbrüche nur auf Basis eines auffälligen NIPT-Tests laut Dr. Beck nicht zulässig sind. Zur endgültigen Abklärung werden invasive Methoden wie eine Plazenta-Punktion oder Fruchtwasseruntersuchung herangezogen. Doch was tun, wenn der Befund tatsächlich auffällig ist? Möchte man über Behinderungen des eigenen Kindes Bescheid wissen?
Invasive Pränataldiagnostik
Invasive Pränataldiagnostik
Zu den invasiven Methoden der Pränataldiagnostik zählen die Plazenta-Punktion und Fruchtwasseruntersuchung. Dabei wird über die Bauchdecke der Mutter Fruchtwasser oder Zellmaterial der Plazenta entnommen und auf Chromosomenveränderungen des Kindes untersucht. Mit der Durchführung eines invasiven Verfahrens steigt das Risiko einer Fehlgeburt.
Macht durch Sicherheit
„Ja“, sagt Eva Kölsch. Sie selbst ist schwanger mit Zwillingen und hat sich für die Pränataldiagnostik entschieden. Nach zwei Schwangerschaften und einer Fehlgeburt möchten die 40-Jährige und ihr Mann nun sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Eva erzählt, dass ihr Ehemann selbst Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung in der eigenen Familie habe. Ein eigenes behindertes Kind großziehen möchte er aufgrund dieser Erfahrung nicht. „Das muss ich akzeptieren.“
Mit zunehmendem Alter der Mutter steigt das Risiko von Trisomien beim Kind, wovon die bekanntesten bereits in der vorgeburtlichen Untersuchung mittels NIPT-Test erkannt werden können. „Am Anfang fand ich es ein bisschen merkwürdig den Test zu machen, so nach dem Motto: Sortiere ich mein Kind aus, wenn es nicht in Ordnung ist? Aber tatsächlich hat sich der Gedanke sehr schnell wieder gelegt. Ich habe dadurch die Entscheidungskraft für mich und die Familie.“
Eva hat bereits zwei Kinder und weiß, dass auch der Umgang mit Geschwisterkindern einen wichtigen Faktor bei der Entscheidung darstellt. Es ist ihr wichtig, vorher über ihr Kind Bescheid zu wissen, um sich bestmöglich darauf einzustellen und wohlüberlegt entscheiden zu können. Im Falle eines auffälligen Ergebnisses bei einem der beiden Ungeborenen würde sie je nach Schwere der Diagnose einen bewussten Abbruch in Betracht ziehen, um das andere zu retten. Würde beispielsweise eine Herzkrankheit festgestellt werden, so hätte dies Auswirkungen auf die Geburtsplanung und die Auswahl einer speziellen Klinik. Eva geht es dabei in erster Linie darum, eigenständig entscheiden zu können: „Dieses Gefühl zu haben, dass ich das in der Hand habe und selbst kontrollieren kann.“ Ihre Stimme klingt bestimmt.

Die Entwicklungen und das Voranschreiten der medizinischen Möglichkeiten befürwortet sie: „Ich finde es gut, wenn sich Eltern frei entscheiden können, ob sie ein behindertes Kind aufziehen können, ob sie die Kraft dazu haben. Ich finde es gut, dass sie die Entscheidungsfreiheit haben, sich dagegen zu entscheiden.“
Dr. Beck betont die Bedeutung der Entscheidungsmacht ebenfalls: „Frauen müssen sich immer fragen: Was hätte es für eine Konsequenz? Würde ein Befund an meiner Entscheidung etwas ändern?“ Die Antwort darauf können nur die Eltern selbst geben. Das Recht auf Nicht-Wissen wird laut der Gynäkologin ebenso respektiert wie das Recht auf eine Beendigung der Schwangerschaft.
Rollen der Ärzt*innen und Medizin
Dass auf einen auffälligen Befund oft ein Schwangerschaftsabbruch folgt, kritisiert die Vorständin des Vereins „weitertragen e.V.“ Cornelia Rödelsperger. Zur Pränataldiagnostik hat die Chirurgin und Mutter einer Tochter mit Behinderung eine klare Meinung.
2012 teilte sie erstmals ihre Geschichte in einem Onlineforum, seitdem setzt sie sich ehrenamtlich für eine stärkere Sensibilisierung für das Thema ein. Ihr Anliegen ist es, betroffenen Frauen Alternativen zur Beendigung der Schwangerschaft aufzuzeigen.
Sie selbst hat sich entschieden, ihre Tochter „weiterzutragen“, als diese in der Frühschwangerschaft mit dem Ullrich-Turner-Syndrom diagnostiziert wurde und die Ärzt*innen aufgrund von markanten Wassereinlagerungen davon ausgingen, dass das Kind noch vor der Geburt versterben würde. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden eine verengte Hauptschlagader und eine zu kleine linke Herzkammer festgestellt.
Über viele Umwege hat Rödelsperger von der Möglichkeit einer vorgeburtlichen Sauerstofftherapie zur Behandlung der Herzfehler erfahren, für die sie sich entscheidet. An einen Erfolg der veranlassten Therapie hatten die Ärzt*innen nach der Schwere der Diagnose zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt. Sie hielten die Fortführung der Schwangerschaft für nicht sinnvoll. „Mir war es aber wichtig behaupten zu können, dass ich alles getan habe, was ich konnte“, sagt Rödelsperger. Sie schätzt sich glücklich, dass ihre Tochter heute mit minimalen Einschränkungen ihr Leben meistert. „Wir hatten wahnsinnig Glück. Wir wussten, wir hatten das Schlimmste hinter uns und alles andere ist machbar.“
Ihre negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik waren der Grund, weshalb sie mit einer weiteren Betroffenen den Verein „weitertragen e.V.“ ins Leben gerufen hat, der nun anderen betroffenen Müttern helfen soll. Frauen und werdende Eltern, die mit ihnen in Kontakt treten, verbindet zumeist das Gefühl der Unsicherheit. Viele sind überfordert, fühlen sich allein gelassen oder haben Schuldgefühle. Häufig liege dies daran, dass Frauen unzureichend unterstützt und über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden.
„Mit einem lebenswerten Leben in diesem Sinne ist nicht zu rechnen.“
Auch Rödelsperger hatte während ihrer Schwangerschaft das Gefühl, seitens der Ärzt*innen regelrecht zum Abbruch gedrängt zu werden. Sie erinnert sich an eine Aussage ihres behandelnden Arztes, auf die Frage, wie sich vergleichbare Fälle mit derselben Diagnose entwickelt haben: „Mit einem lebenswerten Leben in diesem Sinne ist nicht zu rechnen. Die meisten Eltern ziehen bereits aus der Chromosomendiagnose die richtigen Konsequenzen. Nach dem verlängerten Wochenende kann ich Ihnen ein Bett vorbereiten.“ Der Weg des Schwangerschaftsabbruchs war vorgezeichnet.
Die Gesetzesregelungen zum Schwangerschaftsabbruch und der Sterbehilfe im Ländervergleich
Wie regeln Deutschland und seine Nachbarländer die Themen Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe? Je dunkler das Land eingefärbt ist, desto liberaler sind die Regelungen. Klickt hier für nähere Informationen zur rechtlichen Unterscheidung zwischen aktiver Sterbehilfe und assistiertem Suizid.
Barbara Schmitz berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Sie legt ihre Brille zur Seite und reibt sich die Augen, bevor sie sagt: „Man hatte das Gefühl, die Ärzte waren immer froh, wenn wir wieder weg waren. Keiner konnte uns wirklich helfen, obwohl man gerade in so einer Situation besonders auf den ärztlichen Rat angewiesen ist.“ Als Philosophin und Referentin arbeitet sie in medizinethischen Fragen wie der Pränataldiagnostik oder Sterbehilfe häufig mit Mediziner*innen zusammen. Das Ideal von Gesundheit, das viele Ärzt*innen sehen, würde in einem Spannungsverhältnis zu Behinderungen stehen. „Ärzte wollen heilen. Menschen mit Behinderung kann man aber nicht heilen.“ Laut Schmitz brauche es bereits in der medizinischen Ausbildung eine Sensibilisierung im Umgang mit Behinderung. Ärzt*innen tragen so häufig unbewusst ein negatives Bild von Behinderung mit sich, was die Entscheidung der Frauen gegebenenfalls zusätzlich erschwert, kritisiert Schmitz.
Dr. Beck schüttelt bei solchen Berichten den Kopf. Dies kann sie aus ihrer Erfahrung nicht bestätigen. Sie sitzt in ihrem Behandlungszimmer im Klinikum Passau, das gleichzeitig auch der Raum ist, in dem sich Betroffene nach einer Diagnose zurückziehen und sammeln können. Es ist Freitagnachmittag, die Flure der Schwangerenambulanz sind leer. An anderen Tagen ist hier deutlich mehr los.
Die meisten Frauen kommen in der 20. Schwangerschaftswoche zu der Spezialistin in die Klinik, nachdem sie vom Frauenarzt in vielen Fällen bereits über eine mögliche Auffälligkeit und die Option einer genaueren Untersuchung aufgeklärt wurden, sagt sie. Manche kommen auch mit einer diffusen Fehlbildungsangst direkt zu Dr. Beck, ohne, dass es einen konkreten Grund zu dieser Annahme gibt. „Sehr oft können wir Entwarnung geben und die Frauen können beruhigt nach Hause gehen.“ Sollte die Untersuchung jedoch auffällig sein und eine schwere Fehlbildung voraussagen, muss Dr. Beck diese Nachricht überbringen. „Das ist schwierig. Aber über die Jahre lernt man, wie man so etwas vermittelt.“ Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liege dann immer beim Paar. „Wir zeigen Möglichkeiten auf, aber wir werden niemanden drängen. Das kann ich guten Gewissens behaupten.“
Und jetzt?
Was bedeutet es, sich mit diesem Wissen für oder gegen das eigene Kind zu entscheiden? Die Macht über ein Leben zu haben? „Ich denke, die Pränataldiagnostik schafft für viele Frauen und werdende Eltern eine Situation, die sie letztlich in den allermeisten Fällen überfordert. Das wird viel zu wenig bedacht. Ich denke, es ist generell eine schwierige und gesellschaftlich bedenkliche Entwicklung, auch wenn es für Einzelfälle durchaus von großer Bedeutung sein kann“, sagt Schmitz.
Gerade bei diesem Thema wird deutlich, wie stark das Selbstbestimmungsrecht der Frau mit dem Recht auf Leben des Kindes in einem Spannungsverhältnis steht. Das Problem: Es gibt keine universelle Antwort, kein Richtig oder Falsch. Je nach Gewichtung eines Rechts wird das andere massiv eingeschränkt. Diese Problematik wird in der Abtreibungsdebatte schon länger diskutiert. In den vergangenen Jahren haben zusätzlich Behinderten-Aktivist*innen ihre Stimmen erhoben, die sich durch die medizinischen Möglichkeiten und Techniken diskriminiert fühlen. Die Pränataldiagnostik und der gesellschaftliche Drang nach Perfektion würden ein Leben mit Behinderung als nicht lebenswert implizieren. „Durch die ganzen neuen Technologien hat man zusätzlich ethische Probleme geschaffen, die man nicht in den Griff kriegen kann“, meint Schmitz.
Allerdings zeigen auch Beispiele und Fälle wie jene von Eva Kölsch, warum die Diagnostik ihre Berechtigung hat und vielen werdenden Eltern ein Stück Sicherheit bieten kann. Dass für Dr. Beck die Pränataldiagnostik „der schönste Fachbereich der Welt ist“, zeigt auch, wie viel Positives die voranschreitenden medizinischen Verfahren mit sich bringen. Ängste zu nehmen und Sicherheit zu vermitteln gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Dr. Beck. Durch die Möglichkeiten der pränatalen Untersuchungen kann sie Unsicherheiten früh und schnell abbauen und Frauen über Prozesse und Entwicklungen in ihrem Körper aufklären. Das Vertrauensverhältnis, das sie zu ihren Patientinnen aufbaut, erstrecke sich oft über die gesamte Schwangerschaft hinweg.
In einer Frage ist man sich sowohl seitens der Medizin als auch der Soziologie einig: Wie die Entwicklung weiterverlaufen wird und welche gesellschaftlichen Folgen sich daraus ergeben, ist bislang schwer abzuschätzen. Dass aufgrund von vorgeburtlichen Diagnosen künftig weniger Kinder mit Behinderung geboren werden könnten, hält Schmitz für gesellschaftlich fatal. Die Themen Inklusion und Integration würden sich dann noch schwieriger gestalten, da Menschen mit Behinderung zunehmend zur Randgruppe werden. Dass 90 Prozent aller Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden, verdeutlicht schon jetzt erste Konsequenzen. Sie plädiert dafür, „Behinderung als eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht eine individuelle Tragödie“ anzusehen.
Ausblick
In Deutschland bleibt die Anzahl der Geburten von schwerbehinderten Menschen im zeitlichen Verlauf bislang weitestgehend konstant. Auch seitdem der NIPT-Test zur Kassenleistung geworden ist seien laut Dr. Beck die Schwangerschaftsabbrüche nicht angestiegen. Warum gerade bei Trisomie 21 die Zahl der Abtreibungen so hoch ausfällt, bleibt offen. Ebenso wie die Frage nach einem lebenswerten Leben.
Aus philosophischer Sicht hält Schmitz fest: „Ein lebenswertes Leben ist nicht an Kriterien geknüpft. Das müssen Individuen für sich entscheiden. Aber wie Individuen sich entscheiden, hängt immer auch davon ab, wie sich die Gesellschaft dazu verhält.“ Daraus könnte man ableiten, dass nur in einer Gesellschaft, in der Menschen mit Down-Syndrom ein selbstverständlicher Bestandteil sind, mehr Frauen und Familien auch bereit wären, diese Kinder anzunehmen. Es geht also um einen gesamtheitlichen, gesellschaftlichen Kontext.
Was macht das Leben also lebenswert? Die Philosophin meint, darüber nachzudenken kann für jeden einzelnen der erste Schritt dazu sein. Sie steht auf und verabschiedet sich. Die nächste Konferenz steht an.



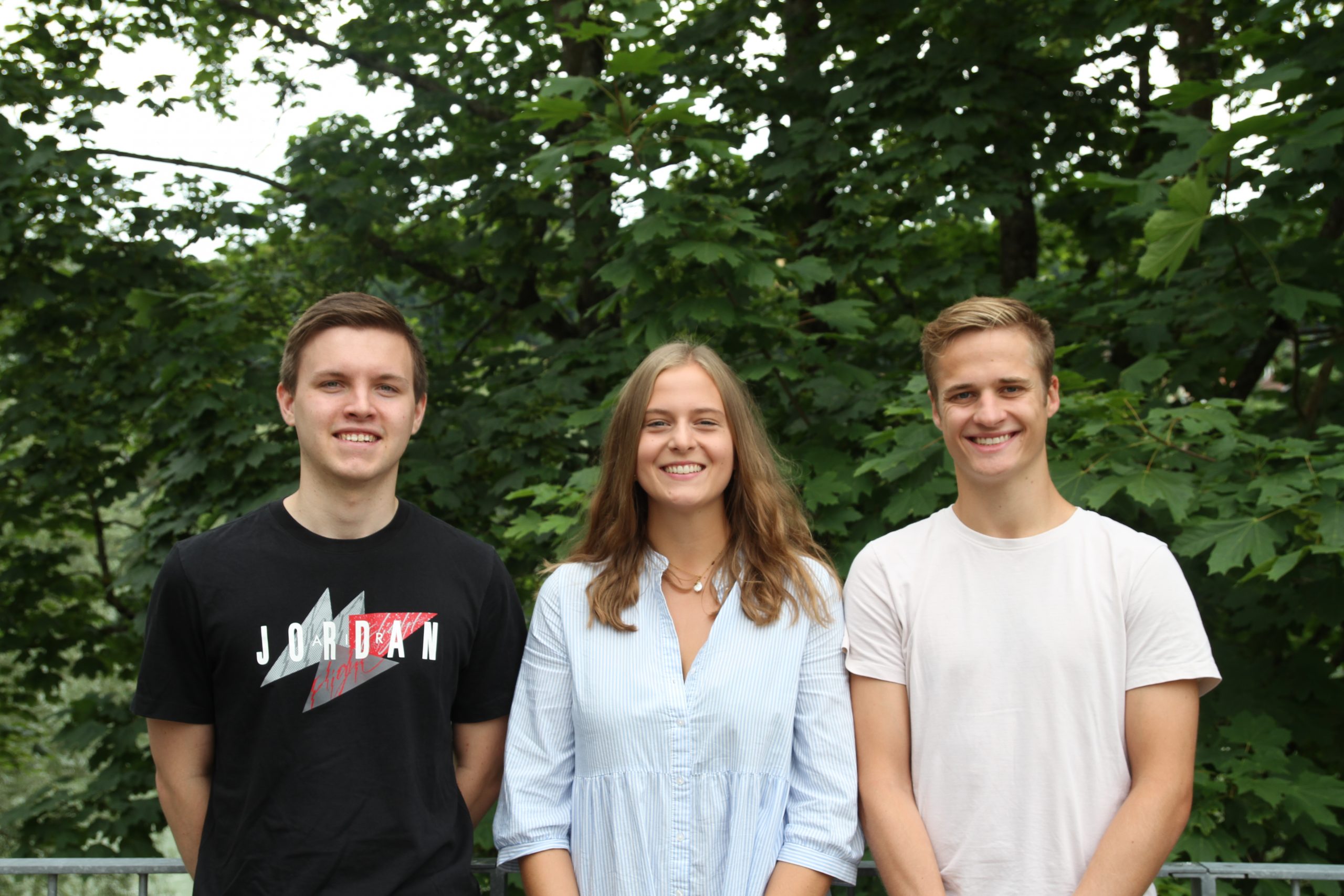







Hinterlasse einen Kommentar